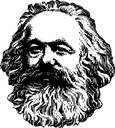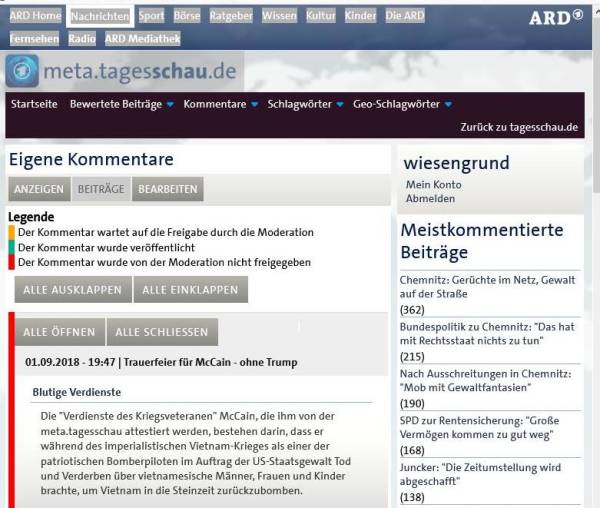Inhaltsverzeichnis
Textbeiträge 2018
An dieser Stelle veröffentlichen wir Texte und Debattenbeiträge. Einen XML Feed für aktuelle Texte und Termine stellen wir unter https://i-v-a.net/feed bereit.
Dezember
„Was man nie gedacht hätte“, Teil 3
Das demokratische Problembewusstsein läuft beim Thema Migration und Flucht zur Hochform auf. Dazu hat IVA Anfang Dezember eine Collage aktueller Begebenheiten von Herbert Auinger (Wien) gestartet. Hier der dritte und letzte Teil der Reihe.
Von Österreich nach Deutschland und wieder zurück: Die Migration als „Mutter aller Probleme“ (Seehofer) vereint die Menschen in ihren Sorgen. Und viele sehen das unterwegs, „was man nie gedacht hätte“. Dazu weitere Fälle aus Altreich und Ostmark, mit einem Blick über die Alpen hinaus.
Wertvolle und Minderwertige (1): Treue zum Vaterland – oder persönlicher Vorteil?
„Und man muss ja auch ganz ehrlich sagen, es hat sich ja auch als richtig herausgestellt, dass es nicht immer die Besten sind, die zuerst von zu Hause weglaufen. Dadurch haben wir eine riesige Kriminalität in diesen Einwanderungsbereichen bekommen… Es gilt letztlich das sicherzustellen, was man auch unseren Eltern und Großeltern im Jahre 1945 nach dem Krieg gesagt hat. Als die vor dem Trümmerhaufen dieser Republik gestanden sind, hat man ihnen auch gesagt: Nicht abhauen von Österreich heißt die Devise, sondern die Ärmel aufkrempeln, fleißig arbeiten und dieses Land aufbauen. Und sie haben dieses Österreich hervorragend aufgebaut, aber das gilt auch für die Osteuropäer: Nicht abhauen von daheim, sondern selbst fest arbeiten und das Land aufbauen, und die reichen Länder werden euch ein bisschen behilflich sein.“ (Jörg Haider, Wahlkampfrede, 24.9.1990)
So hat sich der Altmeister anlässlich der ersten Migrationswelle nach der Auflösung des Ostblocks verbreitet. Die damaligen Minderwertigen stammten übrigens durch die Bank aus dem christlichen Abendland, damals war der Islam eben kein beherrschendes Thema. Die Wertvollen wieder zeichnen sich dadurch aus, dass sie alles mitmachen, sich für alles hergeben und sich alles gefallen lassen, im Krieg wie im Frieden. Sie sind die bedingungslos Zuverlässigen, die fraglos für alles zur Verfügung stehen, was das Land – das ihnen als „ihr“ Land gilt – gerade verlangt. Unverwüstlich jedenfalls, sogar wenn das Land, dem sie ergeben sind, eine kriegsbedingte Transsubstantiation durchmacht, vom faschistischen Dritten deutschen Reich zur demokratischen Zweiten österreichischen Republik. Die Wertvollen fragen nicht, was sie denn davon haben, sie sind unverbrüchlich dabei und bis zum Exzess dafür. Sie sind treu – auch in schlechten Tagen, in Armut und Krankheit, bis dass der Tod usw. Darauf dürfen sie dann richtig stolz sein, nach Meinung genau der Machthaber, die ihnen wie schon seinerzeit den „Eltern und Großeltern“ sagen, was sie in Krieg und Frieden alles zu erledigen haben.
Von zu Hause wegzugehen und im Ausland kriminell zu werden, das ist umgekehrt eine schlüssige, naheliegende Laufbahn – aus völkischer Sicht. Nicht etwa, weil öfter der legale Erwerb in Österreich diskriminiert oder verboten wird, sondern weil schon das Fortgehen den Charakter offenlegt. Wer an sich denkt, wem seine Interessen wichtiger sind als das Vaterland, der betätigt sich als Deserteur. (Auch dann, wenn es seiner Heimat gelegen kommt, unbenutztes Proletariat zu exportieren, um wenigstens Überweisungen aus dem Zielland zu lukrieren.) Ein wirklich anständiger Mensch geht mit und für die Heimat durch dick und dünn, macht unbeirrbar alle guten und schlechten Zeiten mit, wie die Politik sie ihm auferlegt. Wer hingegen berechnend für den persönlichen Vorteil unterwegs ist, wer die Frage nach seinem Nutzen oder Schaden stellt, der wird vermutlich in Österreich zum Verbrecher, denn alle ökonomischen Mechanismen und Momente der Lohnarbeit für Kapital, so wie Haider sie geschätzt hat, zeitigen sachzwanghaft das Ergebnis, nicht für sich zu schuften, sondern für Kapital und Staat. Wer keine praktische Selbstlosigkeit gegenüber der Heimat aufbringt, wird im Ausland mit dieser Form der Arbeit Probleme kriegen, weil er damit garantiert nicht reich und glücklich wird, er ist daher ein potentieller Krimineller. Eine interessante Auskunft über Lohnarbeit!
Wertvolle und Minderwertige (2): Arm wie ein Flüchtling – durch Arbeit für Österreich!
Eine speziell weibliche Ausprägung dieses „Ich-mache-alles-mit“-Standpunkts ist die von der FPÖ so verehrte „Trümmerfrau“, die auch in Deutschland in Ehren gehalten wird. In Ansehung ihrer spezifisch weiblichen Verdienste kriegt sie für ihre sowohl im Faschismus wie in der Demokratie praktizierten Tugenden von Haiders Nachfolgern endlich das spendiert, was sie aus deren Sicht für ihre Selbstlosigkeit verdient: ein Denkmal. Der FPÖ-Politiker Strache liefert für den Wahlkampf 2017 zudem ein Update von Haiders Lob der „Kriegsgeneration“; er bilanziert in einer Aussendung auf seine Weise das beeindruckende Resultat einer lebenslangen Berufstätigkeit im Kapitalismus, um „das Land aufzubauen“ – ein Aufbau, der bekanntlich nie fertig ist: „Pensionisten, die ihr Leben lang berufstätig waren, hart gearbeitet haben und immer genug Steuern gezahlt haben, erhalten derzeit oft weniger Pension, als Mindestsicherung und Sozialleistungen für einen Wirtschaftsflüchtling ausmachen.“ (FPÖ, Brief im Wahlkampf 2017)
Ohne Zweifel ein Skandal, erstens in Bezug auf das Verhältnis von Lohn und Leistung im Betrieb sowie zweitens als Ergebnis vieler Pensionsreformen, nicht zuletzt unter Mitwirkung der FPÖ während der ersten ÖVP-FPÖ-Koalition: Die Angesprochenen sind ganz offensichtlich nicht die Nutznießer ihrer lebenslangen harten Arbeit, sie werden also ausgebeutet und sind nach dem Arbeitsleben so dran wie vorher, sie sind deswegen existentiell auf das angewiesen, was der Staat ihnen zugesteht oder nicht, dem sie faktisch als Bittsteller gegenübertreten. Sie sind insofern in der gleichen blöden Lage wie ein Flüchtling – dumm gelaufen, das mit der harten Arbeit in und für Österreich! Natürlich haben sie ein Recht auf eine Pension, aber wie viel die ausmacht, geldmäßig, das wird höheren Orts entschieden – oft weniger als „Mindestsicherung und Sozialleistungen“. Das behauptet zumindest die FPÖ, ohne sich für solche Zustände zu genieren, weil es Einheimischen sofort besser geht, sobald Ausländer noch elender gestellt werden! Damit genau diese unangenehme Sorte Arbeit für andere noch effizienter, noch „flexibler“ ausgenutzt werden kann, wurde höheren Orts bekanntlich per Gesetz die täglich und wöchentlich mögliche Höchstarbeitszeit verlängert. Der nächste, bereits angekündigte Schritt besteht in der Verschärfung der Kriterien und in der gleitenden Senkung der Arbeitslosenunterstützung, damit die Einheimischen sich dadurch gefälligst den anständigen Standpunkt „Wir nehmen jede Arbeit an!“ aufzwingen lassen.
Regulär erarbeitete Pensionen oszillieren um das anerkannte Existenzminimum, das auch Leute kriegen, die nicht für sich sorgen können oder dürfen, wie z.B. Flüchtlinge. Dieser vernichtende Befund wird von niemandem missverstanden als Kritik an der Ausbeutung; dass auch weitere Pensionsreformen zur „nachhaltigen Sicherung“ folgen müssen, ist angekündigt. Es geht um Höheres: Österreicher, die das alles mitmachen – hart arbeiten und nichts davon haben, am Ende des Arbeitslebens daher so dastehen wie ein Flüchtling –, dürfen sich das als ihren Anstand und ihre erbrachte Leistung, als ihren Beitrag zum Gelingen des österreichischen Standorts anrechnen lassen. Dafür dürfen sie verlangen, dass die Politik Hass, Neid und Missgunst gegen Ausländer nicht nur anstachelt, sondern auch bedient. Ein Privileg muss das Österreicher-Sein bleiben! So geht der Einsatz der FPÖ für die „kleinen Leute“ – die allenthalben fortschreitende Entrechtung von Ausländern ist die Privilegierung der Einheimischen. Eine „Soziale Heimatpartei“ eben!
Wertvolle und Minderwertige (3): Vom Nutzen und Nachteil freier Bürger bzw. Sklaven
Kein Wunder, dass auch im Ausland solche beliebig verwendbaren nationalen Nützlinge überaus geschätzt werden – von Politikern. Der italienische Innenminister Salvini lässt sich vor Begeisterung über seine Landsleute zu aufschlussreichen Komplimenten hinreißen: Es könne nicht darum gehen, so stellt er im September 2018 bei einem EU-Ministertreffen fest, die Besten aus der afrikanischen Jugend herzuholen, um Europäer zu ersetzen, die keine Kinder bekämen. „In Italien gibt es die Notwendigkeit, unseren Kindern zu helfen, Kinder zu bekommen – und nicht, neue Sklaven zu haben, um die Kinder zu ersetzen, die wir nicht haben.“ Vielleicht gebe es diesen Bedarf in Luxemburg, nicht aber in Italien. Asselborn unterbrach ihn erbost, verwies auf die italienischen Gastarbeiter und fügte ein „Scheiße noch mal“ hinzu (https://www.n-tv.de/politik/Salvini-und-Asselborn-geraten-aneinander-article20624357.html).
Salvini braucht keine afrikanischen Sklaven – er hat ja Italiener! Die müssten dafür allerdings auch ausreichend gezüchtet werden. Der „Sklave“ steht natürlich für Ausbeutung; ein Soziologe nennt so etwas ein „funktionales Äquivalent“ – beide Sorten von Werktätigen, die afrikanischen und die italienischen, erbringen dieselbe Leistung. Aber was spricht in Salvinis Augen dann noch immer gegen „Sklaven“, auch wenn sie die Schufterei genauso hinkriegen würden wie Eingeborene? Hat er Vorurteile oder denkt er weiter, auch an die gehobenen Ansprüche des Vaterlandes, auf die Haider damals angespielt hat? Klar, die „Sklaven“ müssen erstens immer noch aus freien Stücken nach Norden kommen und könnten auch wieder gehen; bei den so geschätzten „Autochthonen“ halten Rassisten das Mitmachen und Aushalten aller nationalen Ansprüche hingegen gewissermaßen für angeboren, für im Blut liegend. Das ist ja das Tolle an vielen „eigenen“ Kindern und zugleich das, was etwa den people formerly known as „Zigeuner“ so abgeht, die praktizieren nämlich das „Abhauen“ als Lebensform – zumindest in der rassistischen Völkerkunde. Zweitens und viel wichtiger – ein Russlandfeldzug wie seinerzeit, wäre der mit Sklaven machbar gewesen? Oder braucht dieser Dienst am Vaterland nicht zwingend den freien Bürger und Volksgenossen?! Warum Salvini „seine“ wertvollen Südtiroler einfach nicht mehr hergibt, ist damit auch klar.
Wertvolle und Minderwertige (4): „Wir sind das Volk!“
Der Volks-Spruch auf den rechten Demonstrationen wiederholt die Begeisterung der Oberen, der Machthaber, über unverwüstlich belastbare Mitmacher – aber als Forderung von unten, als missachtetes Recht der Bürger: „Macht mit uns alles, was die Nation voranbringt – aber gefälligst exklusiv mit uns, und nicht auch noch mit Ausländern!“ Nur gegenwärtig, im Zeitalter der „Globalisierung“ mit den vielen nützlichen auswärtigen Touristen, Diplomaten, Geschäftsleuten, Investoren und Arbeitskräften wäre eine konsequente Abschottung der – ziemlich unpraktische – „Verrat“ am Vaterland. Das müssen sich die da unten von denen da oben sagen lassen, denn die klare Ordnung von oben und unten gilt, ob nun Faschismus oder Demokratie herrscht.
Das Nationalsozialismus-Narrativ: Ein Zerrbild
Der Vergleich mit oder die Bezugnahme auf den Nationalsozialismus ist ständig präsent, von Anne Frank über die Konzentrationslager und die Fluchtrouten-Schließer bis zur Trümmerfrau: Jeder bedient sich, als stünde da eine universell verfügbare Bedürfnisanstalt für Rechtfertigungen aller Art in der Landschaft. Gerade durch die exzessive Verwendung wird allerdings eines unübersehbar: Das alles passt hinten und vorne nicht zusammen. Alle gehen sie von der Unvereinbarkeit der Gegenwart mit dem Nationalsozialismus aus und thematisieren doch ständig die vielen Gemeinsamkeiten. Die einen verstehen die Welt nicht mehr („was man nie gedacht hätte“), weil rassistische Positionen salonfähig werden, die früher als „unvereinbar“ mit der Demokratie gegolten haben – die anderen berufen sich auf eben diese angebliche Unvereinbarkeit und Unvergleichbarkeit, um den aktuellen Rassismus salonfähig zu machen.
Am Anfang stand das Diktat der Sieger. Die bedingungslose Verurteilung des Dritten Reichs ohne jedes Verständnis war eine conditio sine qua non des Wiederaufbaues. Der deutsche Wiederaufstieg durch das deutsche Mitmachen in der westlichen Weltwirtschaftsordnung und im westlichen Militärbündnis war nur im Wege der totalen Absage an den gescheiterten „Rechtsvorgänger“ zu haben. In der Adenauer-Republik war diese Absage nach der „Umerziehung“, der „Re-Education“ der Alliierten, nur zu gut als eine aufgenötigte, geheuchelte Pflichtübung kenntlich. So richtig perfektioniert und zur ehrlichen Abscheu weiterentwickelt wurde diese Absage von der deutschen Studentenbewegung der Jahre 1968 ff. Die jungen Leute hatten die Unglaubwürdigkeiten der vorherigen Darstellung bemerkt und lösten sie in die verkehrte Richtung auf, bauten sie nämlich zur kompromisslosen, fanatischen Abgrenzung aus.
Die fundamental gemeinte Verurteilung des Dritten Reiches und die Durchsetzung des dazugehörigen Ekels in der Öffentlichkeit – das wesentliche Moment dafür waren natürlich die Vernichtungslager, vieles andere aus der „dunklen Zeit“ war ja nicht gerade „einzigartig“, wie eine einschlägige Vokabel lautet – waren allerdings ohne eine kleine Verharmlosung des Nationalsozialismus nicht zu haben. Und diese Verharmlosung – um nicht zu sagen: Verniedlichung – besteht in der Entpolitisierung der „Verbrechen der Nazi-Zeit“. Um den Einbruch eines jenseitigen Bösen soll es sich gehandelt haben, um einen unerhörten „Zivilisationsbruch“ (Dan Diner), der jedenfalls nichts mit Staat, nichts mit Nation, nichts mit Politik zu tun gehabt habe, jedenfalls sicher nichts mit dem alleinigen Impetus des damaligen politischen Programms unter Hitler: Make Deutschland great again! Politik im Interesse Deutschlands kann, darf und soll es nicht gewesen sein, was aber dummerweise vor der Niederlage niemand wissen konnte! Insofern formuliert das Attribut „einzigartig“ den totalen Freispruch: Staat, Nation, Politik, Patriotismus sind exkulpiert, und darauf beruft sich der aktuelle Rassismus. Was sollte denn Politik gegen Ausländer und Flüchtlinge mit einem unpolitischen, jenseitigen, absoluten Bösen zu tun haben?
Der damalige Kanzler Vranitzky hat diese Quintessenz als „Antithese“ von Demokratie zum Faschismus formuliert; von radikal-links lautet eine ähnliche Absage, der Faschismus sei „keine Meinung, sondern ein Verbrechen“. Da täuscht man sich gewaltig, denn auch Faschisten haben eine „Meinung“ in dem Sinn: Sie nehmen Stellung zu den Problemen und Drangsalen der Nation, sie definieren besagte Probleme und Lösungen zwar anders – aber auch Faschisten beziehen sich darauf und halten unter Umständen die Demokratie für eine den „Herausforderungen der Zeit“ nicht mehr gewachsene Staatsform und die „Rassenmischung“ (heute: Multikulti) für ein Verbrechen. Insofern handelt es sich beim Verhältnis Demokratie vs. Faschismus nicht um eine trennscharfe Abgrenzung, nicht um ein brachiales „Anti“, sondern um ein Kontinuum mit vielen, vielen Überschneidungen und Gemeinsamkeiten: Der Faschismus ist eine Weiterentwicklung der demokratischen Staatlichkeit, historisch wie logisch. Es ist eine Frage der Umstände – genauer: des Erfolgs der Nation –, ob Patrioten die Demokratie für die adäquate Staatsform halten oder sich in der Stunde der nationalen „Herausforderung“ für eher „autoritäre“ Strukturen und offen rassistische Lösungen gewinnen lassen.
Aktuell charakteristisch ist dafür die vorauseilende oder hinterherlaufende Anpassung der öffentlichen Meinung nach den rechten Erfolgen, und zwar durch die Verschiebung gewisser politischer Positionen von der Kategorie „Rechtsextremismus“ hin zu „Populismus“. Die Subsumtion faschismusverdächtiger Standpunkte unter „Rechtsextremismus“ war ein Versuch der Ausgrenzung, war der gescheiterte Anlauf, deren Unverträglichkeit mit der Demokratie nachzuweisen. Werden dieselben Positionen als „Populismus“ eingeordnet, macht sich das Bedürfnis nach Inklusion bemerkbar: Man hält sich zwar ein wenig die Nase zu, unappetitlich mögen sie schon sein, diese Populisten, aber wenn sie doch unstrittig innerhalb der und durch die Demokratie reüssieren, weil sie die „Ängste“ braver Wähler so gekonnt manipulieren und ausbeuten – ja, genau wie „damals“! –, dann gehören sie letztlich dazu und sind welche „von uns“!
Ob es sich bei manchen politischen Positionen und Aussagen realiter um „Verbrechen“ handelt, wie der Antifaschismus moniert, hängt dann an der Auslegung des NS-Verbotsgesetzes. Dieses Gesetz verbietet die „nationalsozialistische Wiederbetätigung“ – d.h., moderne Faschisten und Rassisten dürfen sich nicht in die Tradition der NSDAP stellen, dürfen öffentlich keine Hakenkreuze verwenden und keine öffentliche Hitler-Verehrung abziehen. Statt einschlägig punzierter Wörter wie „Rasse“ können auch andere, zeitgemäße verwendet werden wie etwa „Kultur“ oder „Identität“. Gar so schwer ist das alles doch nicht, und durch die immer seltenere, halbherzige „Distanzierung“ im Nachhinein nach der jeweils letzten unsensiblen „Wortwahl“ werden die berühmten „Grenzen“ des Anstands sowieso immer mehr verschoben. Die „Judenfrage“ wiederum stellt sich heute ohnehin ganz anders als damals; der moderne „Antisemitismus“ ist eben keine überzeitliche Konstante, die es gibt, weil es sie immer schon gegeben hat. Vielmehr handelt es sich um eine Variante der Völkerfreund- bzw. -feindschaft, die durch politische Umstände bedingt und begründet ist. Das belegt nicht zuletzt das Bemühen der FPÖ, die Vergangenheit der eigenen Partei dadurch zu bewältigen, dass man von echten Juden einen Persilschein ausgestellt bekommt: Hohe Funktionäre fahren nach Israel, auf der Suche nach halbwegs repräsentativen Juden, die sich ihre Anbiederei gefallen lassen, weil sich die Kultusgemeinde in Wien dafür nicht so recht hergeben will. Und die AfD in Deutschland gründet eine Arbeitsgemeinschaft der Juden in ihrer Partei, flämische Faschisten suchen ähnliche Bündnisse…
Vor dem Schluss noch’n Gedicht: Lehren aus der Geschichte für Unbelehrbare
Eine „profil“-Titelgeschichte (profil 19, 7.5.2018) widmet sich einem Ornithologen, einem Vogelkundler, der eine sehr ordentliche Karriere hingelegt hat, im und nach dem Dritten Reich. Er hatte sich seinerzeit zur Waffen-SS gemeldet, war dadurch unter anderem in Auschwitz tätig und betrieb auch während seiner Dienstzeit im Vernichtungslager Vogelforschung. Nach dem Krieg war der Mann drei Jahre im Knast und machte dann weiter Karriere. „Der Vogelfänger von Auschwitz“ ist die Geschichte betitelt. Das österreichische Magazin sieht darin allen Ernstes ein Beispiel dafür, dass die „Geschichte noch lange nicht zu Ende geschrieben“ ist – auch wenn man hier, abgesehen von der Vogelkundler-Biographie, nichts über „Geschichte“ erfährt, was man nicht schon vorher gewusst hätte. Das Wirken des Ornithologen gilt dem kritischen Magazin als „bizarr“, als „beklemmend“. Das überzeugt aber nur, wenn man von einem etablierten Dogma, dem politisch korrekten NS-„Narrativ“, einfach nicht lassen will: dass nämlich der Nationalsozialismus eine derart monströse, „einzigartige“, aus Raum und Zeit gefallene Veranstaltung gewesen ist, für die ein „normaler“ Mensch – die „Normalität“ soll durch das ordentliche, nicht weiter aufsehenerregende Mitmachen in den Verhältnissen vorher und nachher bewiesen sein – eigentlich nicht gemacht, nicht geeignet sein kann.
Diese Vorstellung ist zwar millionenfach blamiert, durch Karrieren vorher, nachher und während des Dritten Reiches, festgehalten in unzähligen Biographien – sie ist aber offenbar nicht zu erschüttern. Vielleicht hat sich auch hier „durch die Hintertür“ eine linientreue Sicht der Dinge „eingeschlichen“? Wobei schwer zu entscheiden ist, was bei solchen Enthüllungen eigentlich angemahnt wird: Glauben die „profil“-Autoren ernstlich, „normale Menschen“ seien nach den Kriterien eines gegenwärtigen, unauffällig-demokratischen, alltagstauglichen Moral- und Gemüts-Haushalts für Massenvernichtungsaktionen, die ein Staat anordnet, einfach ungeeignet, so dass in der Biographie des Vogelkundlers und vieler seiner Zeitgenossen ein kleines Wunder vorliegen muss, weil so ein Mensch eigentlich nie wieder einen Platz im Leben einer „normalen“ Gesellschaft hätte finden können? Oder wird da bloß bekrittelt, dass nach 1945 viel zu wenig Wert auf die öffentliche Darstellung solcher Lebenslügen gelegt wurde, wo wenigstens ein größerer Karriereknick beim Vogelforschen angebracht gewesen wäre, bloß damit „profil“ leichter an seinem Weltbild festhalten kann? Als ob davon etwas abhängen würde: Dieses Weltbild ist durch einen „Faktencheck“ ohnehin nicht zu erschüttern. Das Magazin „profil“ möchte sich engagierte Nazis eben unbedingt als Untermenschen vorstellen können und kommt ins Schleudern, weil das vor und nach dem Krieg so schwer zu bemerken war.
Der Schluss: Ein Reset ist fällig
Also: Der ganze, jahrzehntelang propagierte und absorbierte Schmarren der Vergangenheitsbewältigung ist zu vergessen. Das etablierte „Narrativ“ von Faschismus und Demokratie ist ein Unding und gehört auf den Misthaufen der Ideologien: Da wird eine zielstrebig konstruierte Nationalsozialismus-Karikatur, ein unpolitisches Zerrbild aus Hass und Hetze, mit einer gegenläufigen Demokratie-Karikatur verglichen. Wer ernstlich etwas darüber wissen will, muss neu anfangen.
„Was man nie gedacht hätte“, Teil 2
Das demokratische Problembewusstsein läuft beim Thema Migration und Flucht zur Hochform auf. Dazu hat IVA Anfang Dezember eine Collage aktueller Begebenheiten von Herbert Auinger (Wien) gestartet. Hier folgt der zweite Teil der Reihe.
In Österreich wie in Deutschland gibt die Migration als „Mutter aller Probleme“ (so Innenminister Seehofer) vielen Menschen zu denken. Kritische Stimmen sehen wieder – „was man nie gedacht hätte“ – das Unheil von gestern auf dem Vormarsch, was andere entschieden zurückweisen. Dazu weitere Fälle aus der deutsch-österreichischen Öffentlichkeit.
„KZ-Kickl“ vergreift sich in bzw. an der Sprache
Die österreichische Regierung treibt in Europa mit Verbündeten wie Seehofer und Orbán einen „Paradigmenwechsel“ bzw. eine „kopernikanische Wende“ der Flüchtlingspolitik voran. Intendiert ist die Abschaffung des ehemaligen Asylwesens. Das ist keine radikale Kehrtwendung, sondern die konsequente Vollendung der diesbezüglichen Kette von Verschärfungen und Einschränkungen, die 2015 durch die „Willkommenskultur“ – die sich „nicht wiederholen darf“ (alle) – kurz unterbrochen wurde. Allfällig anlandende Flüchtlinge sollen durch totale Chancen- und Perspektivlosigkeit abgeschreckt oder gleich von Europa ferngehalten werden; zu diesem Behuf sollen Unbelehrbare, die den Transit dennoch versuchen, nach australischem Vorbild in Flüchtlings-KZ‘s festgehalten werden, und zwar auf dem Balkan oder in Nordafrika. In solchen Lagern sind sie dann, wie in jedem Knast, in „Sicherheit“ vor „Verfolgung“ – was die Einrichtungen sicher wohltuend von den schon bestehenden in Libyen unterscheidet!
Innerhalb Österreichs plant die Regierung, Asylwerber künftig in „Grundversorgungszentren“ zu „konzentrieren“. Wenn ihnen dann das Geld weggenommen wird, um sie mit „Sachleistungen“ zu füttern, sie aber für jedes Bedürfnis außerhalb des Lagers weiter Geld brauchen, das sie nicht haben, sind sie aufs Betteln oder auf Kleinkriminalität wie Ladendiebstahl, Drogenhandel, Prostitution verwiesen – da ergibt sich wie von selbst die Notwendigkeit, die Bevölkerung vor ihnen zu „schützen“. Dass dann, wie in jedem Anhaltelager (so der Terminus aus der eigenständigen österreichischen Lagertradition, siehe Wikipedia), „Anwesenheitspflicht“ herrscht und dass, wie in jedem KZ, die „Hausordnung“ respektiert werden muss, wird ebenfalls zur Selbstverständlichkeit. Es geht nur mehr darum, die Betroffenen entweder in ihre Herkunftsländer oder in den zuständigen EU-Staat abzuschieben, wozu es blöderweise die Zustimmung der betreffenden Länder braucht. Alles, wie gesagt, zum Schutz der Bevölkerung. Die bisherigen Fortentwicklungen der Rechtslage in Sachen Asyl- und Sozialpolitik haben ohnehin längst einen gesellschaftlichen Bodensatz von Leuten erzeugt, die sich notgedrungen auch außerhalb der Legalität durchschlagen – in klassischer Terminologie ein „Lumpenproletariat“. Das „Verbrechen“ dieser Leute besteht darin, zur falschen Zeit an einem Ort, an dem sie nicht existenzberechtigt sind, aufgetaucht oder gestrandet zu sein.
Während sich Europa immer mehr zur praktisch gültigen Definition der Flüchtlinge als feindliche Zivilisten hinarbeitet, führt die bisherige Unterbringung in Privatquartieren zu unerwünschter Unterstützung dieser Asylwerber, etwa zur Integration als Lehrlinge, Schüler, Berufstätige oder zu unerwünschten Erfolgen beim Deutschlernen. Um das zu unterbinden, ist die Lagerhaltung solcher Leute das Nächstliegende. Das Bonmot eines Journalisten aus dem vorigen Jahrhundert – Österreich werde vom Asylland zum Asylgrund – wird zum positiven Programm der ÖVP-FPÖ-Regierung: Den Flüchtlingen soll praktisch, d.h. von Staats wegen bewiesen werden, dass es ihnen in Österreich mindestens so dreckig geht wie in den Zuständen, vor denen sie weglaufen – alles andere würde verlockende, so genannte Pull-Faktoren in Gang setzen. Insofern ist der Vergleich solcher Anhalte- und Abschiebelager mit einem klassischen KZ angebracht. Und genau diesen Vergleich wollte der österreichische Innenminister Kickl anregen, um ihn „zurückweisen“ zu können.
„Kickl selbst erklärte…, dass er damit keinesfalls auf Konzentrationslager angespielt habe. Er weise jegliche Verbindung zwischen dem Begriff ‚konzentriert‘ und Begrifflichkeiten des ‘verabscheuungswürdigen NS-Verbrecherregimes’ entschieden zurück. ‚Konzentriert‘ habe sich inhaltlich ausschließlich auf eine zeitlich und strukturell geordnete Durchführung von Asylverfahren im Interesse der Schutzbedürftigen und des Gastlandes bezogen… In seiner Pressekonferenz zur Asylbilanz 2017 hatte Kickl erklärt: ‚Es ist nur ein Begriff, diese Grundversorgungszentren, für eine entsprechende Infrastruktur, wo es uns gelingt, diejenigen, die in ein Asylverfahren eintreten, auch entsprechend konzentriert an einem Ort zu halten, weil es unser gemeinsames Interesse sein muss, sehr, sehr schnell zu einem entsprechenden Ergebnis auch zu kommen‘.“ (Der Standard, 12.1.2018)
Eine solche Zurückweisung ist natürlich mit einer Widerlegung oder einer diesbezüglichen Begründung nicht zu verwechseln; es handelt sich um eine autoritative Sprachregelung, die mit Hilfe der Medien von der Meinung der Herrschenden zur herrschenden Meinung avancieren soll. Wie erfolgreich Kickl damit war, belegen die Einwände oppositioneller Bedenkenträger – nicht gegen das Projekt, lediglich gegen die „Wortwahl“! Heftige Kritik daran kam unter anderem von den Neos (der liberalen Partei „Das Neue Österreich“) und den Grünen aus der Opposition. Neos-Asylsprecherin Steffi Krisper zeigte sich „entsetzt“: „Dass dem für seine Wortspiele und Reime so bekannten Innenminister so eine Formulierung schlicht passiert, kann ich beim besten Willen nicht glauben. Es wirkt eher, als ob es sich – wie ja schon oft gesehen – um eine bewusst gesetzte Provokation handelt, die dann im Anschluss nur halbherzig zurückgewiesen wird. Ich erwarte mir hier vom Innenminister eine echte und glaubwürdige Entschuldigung.“ „Bis hierher und nicht weiter, Herr Kickl!“, richtete Maria Vassilakou (Grüne) dem blauen Minister per Aussendung aus: „Diese bewusste Formulierung schürt nicht nur Angst in der Bevölkerung, sondern ist ein unerträgliches Spiel mit der dunkelsten Zeit unserer Geschichte. Kickl hat heute eine Grenze überschritten. Ich verwehre mich dagegen, dass sich die Sprache des Nationalsozialismus durch die Hintertür in unser Denken und Fühlen einschleicht.“ (Der Standard, 11.1.2018)
Der Minister macht das also mit Absicht, und was wird von ihm erwartet? Wieder mal ein Stück Heuchelei: Lügen Sie mich gefälligst an, Herr Minister, aber glaubwürdig! Der Vorwurf lautet im Klartext, Kickl habe sich nicht an die Konvention der „antifaschistischen“ Lebenslüge gehalten. Er habe mit einem Vergleich des – angeblich – Unvergleichlichen „gespielt“, er habe zugelassen oder gar provoziert, dass sich der Verdacht einer ziemlich „dunklen“ Gegenwart „einschleicht“ in unser Bedürfnis nach einer heilen demokratischen Welt, die wir durch intensives Kopf-in-den-Sand-stecken verteidigen müssen. Kickl steht für härteres Durchgreifen gegen die vorgestellte Bedrohung durch Flüchtlinge, und gerade deshalb sind auch sprachliche Zimperlichkeiten unangebracht. Die konzentrierte Lagerhaltung von Flüchtlingen soll schließlich bemerkt werden und abstoßend wirken. Die paar Jahrzehnte, in denen Europa ohne solche Lager auskam, sind passé, wobei der Minister darauf besteht, dass jeder Vergleich mit den Lagern aus dunkler Zeit unzulässig ist, gerade weil er sich aufdrängt. Der Grund ist ganz einfach: In der heutigen Demokratie soll man das glatte Gegenteil des Faschismus sehen – so beuten die Rechten dieses verlogene, über Jahrzehnte etablierte „Narrativ“ aus. Da braucht ein Verantwortungsträger also keinerlei verbale Berührungsängste an den Tag zu legen. Und was wird ihm vorgeworfen? Er habe gegen einschlägige Sprachregelungen verstoßen, also die Ruhe gestört, bei Grün und Pink…
Und was heißt hier eigentlich „Hintertür“? Der Minister sagt doch ganz offen und pro domo, worauf es ihm ankommt! Die Vorstellung vom „Einschleichen“ einer inakzeptablen „Sprache“ (also nicht von Urteilen, sondern von Wörtern!) „in Gedanken und Gefühle“ unterstellt offensichtlich das Ernstnehmen jener anerkannten Karikatur des Nationalsozialismus, die durch die „antifaschistische“ Nachkriegs-Geschichtsschreibung etabliert wurde: dass nämlich seinerzeit niemand etwas gewusst, gewollt und organisiert betrieben hat – von Hitler persönlich und einigen Komplizen abgesehen –, sich vielmehr fast unbemerkt – nämlich durch die „Hintertür“ – die Beteiligung der „Kriegsgeneration“ an einem letztlich unerklärlichen, unpolitischen nationalen Aufbruchs- und Vernichtungsprogramm „eingeschlichen“ hat. Der Minister hat sich jedenfalls nicht einmal unglaubwürdig entschuldigt. Andere schon. Die beeindruckenden Resultate dieses Bemühens um unverwechselbare demokratische Sprachregelungen beim Hetzen in Sachen Migrationsproblem dokumentiert eine geläuterte FPÖ-Funktionärin. Ihr war das Wort „Untermensch“ rausgerutscht, worauf sie klarstellte, dass man das Wort vermeiden sollte, wenn man über Untermenschen redet, damit die Partei nicht in Misskredit kommt. Die Dame bereut mittlerweile ihr Posting. „Das war mir nicht bewusst, dass ‚Untermensch‘ ein Nazi-Wort ist“, erklärt sie auf Anfrage des „Standard“. Das Posting wurde nach einem Bericht der „Niederösterreichischen Nachrichten“ gelöscht… „Ich distanziere mich davon.“ (Der Standard, 8.7.2018)
Kurz vergleicht sich mit Nazis – und zückt die Nazi-Keule
Jedes Frühjahr legt die Republik Österreich, getrennt von der und zusätzlich zur Tagespolitik, ein paar andächtige, feierliche, ergreifende Minuten ein. Die Republik feiert sich, nicht indem sie auf ihre aktuellen Leistungen und „Reformen“ pocht, sondern durch das pompöse Herumreiten auf einer Unterlassung: Nein, heute stehen gewisse Vernichtungsaktionen aus dem Programm des staatlichen Vorgängers nicht auf der Tagesordnung. Hier und heute werden keine Juden vom Staat umgebracht, wie seinerzeit Anne Frank. Chapeau! Durch das rituelle „Gedenken“ der und das „Erinnern“ an die Vergangenheit wird ausschließlich der Gegenwart „gedacht“; über den in solchen Sternstunden gezielt gesuchten Vergleich mit dem „verabscheuungswürdigen NS-Verbrecherregime“ geilt sich die Republik an ihrer eigenen Gutheit auf. Das denkbar größte Menschheitsverbrechen – hier und heute findet es nicht statt! Wahnsinn!
Im Jahr 2018 wird vom ÖVP-Parlamentspräsidenten der Schriftsteller Köhlmeier für eine Rede eingeladen, denn was wäre eine solche der nationalen Selbstbesinnung gewidmete Feierstunde ohne einen „Mahner“, einen Gewissenswurm und wirklich „Unbequemen“, wie sie von der Politik so geschätzt werden. Köhlmeier macht einen guten Job, er erinnert an ein paar bekannte „Einzelfälle“ – und abschließend überschreitet auch er eine Grenze, um ein paar Millimeter. Er macht nämlich den Schwenk von der degoutanten Gesinnung in die politische Praxis: „Meine Damen und Herren, Sie haben diese Geschichten gehört, die von den jungen Menschen gesammelt wurden. Und sicher haben Sie sich gedacht, hätten diese armen Menschen damals doch nur fliehen können. Aber Sie wissen doch, es hat auch damals schon Menschen gegeben, auf der ganzen Welt, die sich damit brüsteten, Fluchtrouten geschlossen zu haben.“ (Rede Köhlmeiers im Parlament)
Das war offenkundig eine Anspielung auf die benachbarten sowie weiter entfernten Staaten, die damals mit Juden auch nichts zu tun haben wollten, wie die Nazi-Presse anlässlich der Konferenz von Evian triumphierend vermerken konnte. Der österreichische Kanzler sieht sich Anno Domini 2018 jedenfalls beleidigt, und zwar durch etwas, was er selber und nicht Köhlmeier fälschlicherweise als seine sachlich gegebene Übereinstimmung mit „Nazis und Nazi-Kollaborateuren“ thematisiert: „Vor allem aber halte ich es für verfehlt, die Schließung der Westbalkanroute mit den Verbrechen der NS-Zeit zu vergleichen. Das weise ich auf das Schärfste zurück. Die Aussage, dass es auch damals Menschen gegeben hat, die Fluchtrouten geschlossen haben, zielt eindeutig auf Nazis und Nazi-Kollaborateure ab.“ (Kanzler Kurz, Tiroler Tageszeitung, 8.5.2018)
Schon wieder so eine „Zurückweisung“ ohne jedes Argument. Also noch einmal von vorn und diesmal Schritt für Schritt: Köhlmeier erinnert an die Abweisung flüchtender Juden durch andere Staaten zu Zeiten, als das Dritte Reich sie noch loswerden wollte – ein schlichtes Faktum! Er vergleicht Österreich also mit diesen Staaten. Kurz fühlt sich zu Recht angesprochen, er hat schließlich seinen letzten Karriereschritt mit der Angeberei bezüglich der „Schließung der Balkan-Route“ bestritten. Dementieren geht also nicht, schließlich liegt eine Gemeinsamkeit vor. Kurz radikalisiert nun den Vergleich, ob aus Böswilligkeit oder Ahnungslosigkeit, das sei dahingestellt. Die türkisen Berufsjugendlichen, die die ÖVP übernommen haben („Türkis ist das neue Schwarz“, heißt es in der Presse 2017 zur neuen Signalfarbe der Partei), sind ja vielleicht typische Produkte des österreichischen Schulwesens und der anerkannten Leitkultur; was heißt: weitgehend ahnungslos in Bezug auf den Nationalsozialismus, und zwar durch die heillose Überfütterung mit dem üblichen Zerrbild. (Dazu Näheres in Teil 3 der Reihe.) Es ist also durchaus möglich, dass Kurz aufrichtig dachte, nur die bösen „Nazis und Nazi-Kollaborateure“ könnten angesprochen sein, als Köhlmeier von den bösen Fluchtroutenschließern sprach, „die sich brüsteten“.
Darauf basiert jedenfalls Kurzens Konter, und der hat es in sich: Gerade wenn „Nazis und Kollaborateure“ Fluchtrouten schließen und damit dasselbe machen wie Kurz – zum letzten Mal: wie vom Kanzler unterstellt und nicht von Köhlmeier behauptet –, gerade beim Vorliegen dieser Gemeinsamkeit ist ein Hinweis darauf total unstatthaft und umgehend zurückzuweisen. Das ist der wundervolle Ertrag der durchgesetzten, konsequent gefakten „Lehren aus der Geschichte“, also der Ertrag des erwähnten Zerrbildes des Nationalsozialismus zur Feier der Gegenwart: Demokratie und Nationalsozialismus, Vergangenheit und Gegenwart sind einfach unvergleichlich. Dieses Dogma gilt, unbeschadet aller faktischen Gemeinsamkeiten. So ein Vergleich gehört sich einfach nicht, gerade wenn eine Übereinstimmung vorliegen würde! So schwingt man die „Nazikeule“ – in den richtigen Händen!
Mord, Totschlag, Vergewaltigung: Deutsch – oder gar nicht!
Ob der Islam ein „Teil Deutschlands“ ist oder werden kann, darüber wird munter gestritten. Dass Verbrechen aller Art zum deutschen „way of life“ gehören, ist hingegen dermaßen anerkannt, dass ein erklecklicher Teil der Unterhaltungsindustrie davon zehrt. Der sonntägliche „Tatort“ hat bekanntlich Kult-Status. Denn dass die vielen Verbote die vielen (im TV dann zur Kurzweil angebotenen) Verbrechen nicht verhindern, ist ebenso bekannt wie anerkannt. Die Staatsgewalt unterbindet nicht, was sie kriminalisiert – vielmehr enthält das Strafgesetzbuch eine ansehnliche und ständig verlängert Liste von Gemeinheiten, Übergriffen und Brutalitäten, die alle regelmäßig verbrochen werden und für die längst in der nächsten Wachstube die passenden Formulare bereit liegen. So geht „das Leben“ im demokratischen Kapitalismus seinen Gang, wobei die regelmäßig anfallenden Morde und Vergewaltigungen routiniert im Lokalteil der Presse durchgenudelt werden.
Es sei denn, die verkehrte Rasse ist involviert! Dann ist echt was los. Dem gesunden Volksempfinden, das sich in Chemnitz und Umgebung im August 2018 bemerkbar machte, ist offenbar „gefühlsmäßig“ selbstverständlich, dass nur echte „Bio-Deutsche“ das Recht haben, in Deutschland als Messerstecher tätig zu werden. Und umgekehrt haben echte Deutsche das Recht, nur von ebenso echten Rassegenossen drangsaliert, getötet, vergewaltigt zu werden. Gegen dieses Geburtsrecht aller Deutschen wurde von Flüchtlingen verstoßen. Bei denen und nur bei denen wird dem Gesetz eine Leistung abverlangt, die es nicht bringt und nicht bringen kann – nämlich die Verhinderung der Untat. Und dann wird dem Staat sein diesbezügliches Versagen vorgeworfen, um zur präventiven Selbstjustiz aus Gründen der Vorwärtsverteidigung unserer Ordnung zu schreiten. – Ganz zeitnah wurde übrigens, um nur ein Beispiel zu nennen, in Wien eine Deutsche von ihrer österreichischen Freundin erdrosselt. In Chemnitz damals: alles ruhig. In Wien auch.
Im österreichischen Innenministerium ist man sich genau so sicher, dass die Inländerkriminalität eine lange, lange Kette aus „Einzelfällen“ und vielen, vielen Ausnahmen von der Regel ist, während es sich bei ausländischen Verbrechern um Repräsentanten einer kultureller Eigenart, also um die Regel handelt. Eine leicht kontrafaktische Sicht der Dinge! Schließlich werden In- wie Ausländer in schöner Regelmäßigkeit eingeknastet, so sie gegen das Gesetz verstoßen und erwischt werden. Aus völkischer Sicht hingegen ist das genannte Szenario der „Ausländerkriminalität“ sehr konsequent, weil ja das Individuum als Individuum nichts gilt, sondern vollständig durch die Zugehörigkeit zu „seiner“ Ethnie definiert und festgelegt ist – und weil das jeweils „eigene“ Kollektiv aus seiner eigenen Sicht jeweils eine Gemeinschaft der „Anständigen“ darstellt. Die „anderen“ können an dieser Sittlichkeit aber nicht teilhaben, weil sie ja „anders“ sind, und wenn sie nicht so sind wie die per Eigendefinition „Anständigen“, sind sie per definitionem unanständig. Fertig ist die rassistische Laube. Das Innenministerium will dieses gesunde Patriotenempfinden jedenfalls unterstützen, und zwar durch eine „Anregung“, die amtliche „Kommunikation“ von Verbrechen betreffend. So sollen in den Medien zukünftig „Staatsbürgerschaft, Aufenthaltsstatus“ und eventuell der Asylstatus von Verdächtigen genannt werden; bei Sexualdelikten, die „in der Öffentlichkeit begangen werden“, auch die „Modi Operandi“ (also die brutalen Einzelheiten) sowie der Grad der „Gewalteinwirkung“ oder der Tatbestand, dass „zwischen Täterin und Opfer keine Verbindung“ existiert hat. Das alles, so die offizielle Ansage, ist „proaktiv auszusenden“. Damit die so gefütterten Medien auch mitmachen, unterscheidet das ermutigende Schreiben zwischen „kritischen“ und anderen Organen der Öffentlichkeit und legt nahe, die Kommunikation mit ersteren „zu beschränken“ und ihnen auch keine „Zuckerl“ (sic!) zukommen zu lassen.
Natürlich wurde im Zuge der dadurch angefachten öffentlichen Aufregung auch an die bekannten, gar nicht alternativen Fakten erinnert: dass der überwiegende Teil von Mord und Totschlag in Österreich innerhalb der Familie oder im „sozialen Nahbereich“ passiert, sich Täter und Opfer einer solchen „Beziehungstat“ also normalerweise länger kennen; dass der gefährlichste Ort im Leben einer Frau die Wohnung ist und nicht der öffentliche Raum; dass die Wahrscheinlichkeit, vom Ehemann/Partner terrorisiert oder getötet zu werden, wesentlich größer ist, als bei einem Terroranschlag ums Leben zu kommen. Aber die gebührende „Kommunikation“ dieser Umstände widerspricht natürlich diametral der regierungsamtlichen Wertschätzung der „Familie aus Mann, Frau und Kindern“, die aus Sicht der ÖVP-FPÖ-Koalitionsregierung nach wie vor gegenüber anderen Formen des Zusammenlebens „privilegiert“ sein sollte – wegen ihres „Mehrwerts für die Gesellschaft“, der selbstverständlich, siehe die obige Bilanz, auf Kosten ihrer Mitglieder geht.
„Angst“ machen Rassenhass verständlich
Nicht nur in Österreich, auch in Chemnitz und Umgebung geht es voran. Publizistische und politische Dominatoren der deutschen Öffentlichkeit äußern ein gewisses Verständnis für den Protest „besorgter Bürger“, nachdem das wahre Opfer der rechten Hetzjagden – die doch gar nicht stattgefunden haben! – gewürdigt wurde. Es ist natürlich das staatliche Gewaltmonopol. Dabei ist egal, dass es gar nicht angekratzt wurde. Eine eindeutige, sehr aufschlussreiche Botschaft geht ins Land. Verständlich sei das Zusammenrotten des gesunden Volksempfindens schon, auch wenn es sich nicht dort herumtreiben darf, wo es gut hinpasst, nämlich bei Neonazis und Rechtsradikalen aller Couleur. Die „Ängste“ der braven Bürger hätten viel für sich und dürften nicht der AfD überlassen, sondern müssten von den etablierten Parteien adoptiert werden. Auch bzw. erst recht, wenn besagte „Ängste“ ziemlich „irrational“ sind.
Diese politisch anerkannte „Angst“ ist kein Faktum, sondern eine gezielte Rechtfertigung. Das merkt man daran, wann diese Denkfigur in Aktion tritt und wann nicht: Millionen Muslimen im Nahen und Mittleren Osten, die seit Jahrzehnten von den USA und europäischen Mitmachern mit Krieg überzogen werden, darf in der hiesigen Öffentlichkeit natürlich keine „Westophobie“ konzediert werden, auch wenn die vielen Gründe für die angeblich unverständlichen Aufwallungen bekannt sind. In einem solchen Falle wäre gleich die Rechtfertigung für den „islamischen“ Terror kenntlich, die es eben nicht geben darf. Deswegen darf außer grundlosem „Hass“ und überschießender Religion dort nichts zur Kenntnis genommen werden, Angst jedenfalls nicht. Umgekehrt, umgekehrt: Wenn ansonsten anständige und unauffällige Bürger rassistisch ausrasten, dann muss irgendetwas „Verständliches“ dahinterstecken – also Angst.
Ebenso unmöglich wie gegenüber Muslimen heute wäre die verständnisvolle Anwendung dieser schönen Deduktion („Angst essen Seele auf“) auf die „unselige Vergangenheit“. Bei der heutigen Befindlichkeit der öffentlichen Moral – wohlgemerkt, die Rede ist von aktuellen Zuständen! – ließe sich ja der damalige Judenhass nach den gegenwärtig gültigen Kriterien ziemlich gut verständlich machen: Spätestens, sobald ein „jüdischer“ Mord oder eine Vergewaltigung an arischen Menschen bekannt geworden wäre, sei es auch nur in Gestalt einer Erfindung der Nazi-Propaganda, hätte doch berechtigte Angst vor „dem Juden“ entstehen müssen. Und auch heute werden schließlich Untaten von Flüchtlingen frei erfunden, vom Ladendiebstahl bis zum Terror-Sympathisantentum. Faktisch zutreffend oder nicht, das ist ohnehin irgendwie scheißegal, so hat es eine Fachfrau für Hetze aus dem Gefolge von Donald Trump in einem ähnlichen Fall verlautbart: „Auf die Frage, ob Trump den Inhalt von Videos nicht besser prüfen sollte, bevor er sie weiter verbreite, sagte Huckabee Sanders: ‚Egal, ob es ein echtes Video ist, die Bedrohung ist echt‘.“ (www.tagesschau.de) Auch die Lüge oder das „stichhaltige Gerücht“ dient immerhin der guten Sache: Wie wahr!
„Was man nie gedacht hätte“, Teil 1
In Österreich wie in Deutschland gilt Migration als Mutter aller Probleme. Das gibt Anlass zu vielen besorgten Fragen: Wie konnte es dazu kommen, wie sieht das aus, wie soll es weiter gehen? In einer Collage aktueller Begebenheiten gibt Herbert Auinger (Wien) Auskunft über das demokratische Problembewusstsein. Hier der erste Teil der Reihe.
Die österreichische Tageszeitung „Kurier“ interviewt den Eröffnungsredner der diesjährigen Salzburger Festspiele, Blom: „Kurier: Was man nie gedacht hätte: Dass Menschen auf dem Weg nach Europa zu Tausenden ertrinken. Blom: Und dass man unter zivilisierten Menschen darüber diskutiert, ob es nicht richtig ist, diese Menschen ersaufen zu lassen. Kurier: Was ist da passiert?“ (Kurier, 25.7.2018) Ja, was ist da los? Und die Kollegin vom „Standard“ fragt gleich nach, ob das nicht – wie schon einmal – in einem ziemlichen Desaster enden könnte. Von heute aus im Nachhinein betrachtet!
Irgendwann wird es wieder verdammt wehtun!
„Man gewöhnt sich daran. Es wird schleichende Normalität. Diese ‚hässlichen Bilder‘: die im Wasser treibenden kleinen Leichen in bunten Strampelanzügen… Es sind eben die falschen Kinder mit falschen Geburtsorten. Irgendwann wird man sich fragen müssen, wie es so weit kommen konnte. Wieder. Und auch, wie es in Europa wieder möglich war, Menschen, die andere Menschen retten, wie des Verbrechens Verdächtige zu behandeln… Die Frage wird einmal schmerzhaft brennen. Wie es in Europa salonfähig wurde, diese Situation herbeizuführen, die schon einmal Realität gewesen ist. Jene, die Anne Frank und ihre Familie versteckten, handelten auch damals schon strafbar und wider das Gesetz. Und jene, die Anne Frank töteten, handelten legal. Legalität ist ein dehnbarer Begriff. Das Sterben aber ist endgültig.“ (Julya Rabinowich, Der Standard, 8.7.2018)
Warum wird man sich erst „irgendwann fragen müssen“, wie es „so weit kommen konnte“? Und nicht jetzt, hier und heute? Warum wird diese Frage erst später „einmal schmerzhaft brennen“? Die Rede ist doch von einer aktuell und sehr praktisch vollzogenen Unterscheidung zwischen mehr oder eben weniger lebenswertem Leben, betreffend nicht nur Kinder mit „falschen Geburtsorten“ – wobei die anspielungsreiche Wortwahl „lebenswert“ verpönt sein mag, aber vorzüglich auf den Sachverhalt passt! Ebenso ist die Rede davon, dass NGOs, die in Europa nicht zugelassene Flüchtlinge unterstützen, zunehmend kriminalisiert werden. Die Zustände erinnern schon deswegen so unverkennbar an Phänomene aus der Vergangenheit, weil an diese so gern staatsoffiziell „erinnert“ wird – schließlich soll sich die gegenwärtige Idylle so billig und so deutlich vom früheren „unmenschlichen Unrecht“ unterscheiden lassen. Und dann das: Die Unterstützung von Leuten, die in Europa nicht existenzberechtigt sind, wird gesetzwidrig oder ist es zum Teil schon, so wie seinerzeit die Unterstützung der zur Nachkriegs-Ikone aufgestiegenen Anne Frank. Ein bitteres „Unrecht“ ist dergleichen also offensichtlich bloß im Rückblick und bezogen auf das Dritte Reich! Zumindest staatsoffiziell.
Und nach den Gründen dafür soll man erst später fragen? Etwa, weil die Suche nach den Schuldigen, nach den Verantwortlichen, die das Absaufen der „falschen Kinder“ billigend in Kauf nehmen, doch eigentlich Sanktionen nach sich ziehen müsste? Und man – da solche Sanktionen nicht absehbar sind angesichts der demokratisch gewählten Verantwortungsträger, die unangefochten im Sattel sitzen – sich deswegen auch die Frage nach dem Warum und Wieso gleich sparen soll? Auch wenn man sich „irgendwann“ später einmal doch noch wird „fragen müssen“ – nachdem vielleicht wieder ein Krieg verloren wurde und die Verlierer von den Siegern moralisch ins Abseits gestellt werden!? Schöner, brutaler, naiver, abgeklärter, realistischer und gruseliger kann man den total verlogenen nackten Kern der berühmten „Lehren aus der NS-Vergangenheit“ kaum vorstellig machen: Es war ein den Verlierern aufgenötigtes Programm nationaler Zerknirschung, später ausgebaut zu einer billigen Selbstbeweihräucherung per Vergleich mit einem jenseitigen, abartigen „faschistischen“ Bösen, zur Aufführung gebracht in regelmäßigen nationalen Ritualen. Dieser Anstrich der nationalen Moral war offenbar passend und einleuchtend, weil in Europa einige Jahrzehnte kein Bedarf nach einem solchen „Absaufen-Lassen“ bzw. nach der angesprochenen Selektion beim Retten aus Seenot bestand.
Die „Legalität“ ist übrigens in keiner Weise „dehnbar“. Reformierbar ist sie selbstredend: „Legalität ist die gesetzliche Zulässigkeit einer Handlung, einer Duldung oder eines Unterlassens“ oder in den Worten des Philosophen Kant: „die äußerlich feststellbare Übereinstimmung einer Handlung mit dem Gesetz ohne Berücksichtigung des Motivs“ (nach Wikipedia). Auch rassistische Gesetze mit Blick auf minderwertige „falsche Kinder“ sind natürlich Gesetze, und sowohl das „Recht“ als auch das – „irgendwann“ im Nachhinein – zum „Unrecht“ erklärte Recht haben die für Betroffene so unangenehme Eigenheit, dass sie gelten, solange die Macht intakt ist, die sie macht und exekutiert.
Rassismus: So alltäglich wie obligatorisch „verdrängt“
Die Antirassismus-Diskussion ist, wie sich das heutzutage gehört, pluralistisch. Was unter „Rassismus“ zu verstehen ist oder nicht, heißt es, sei eine Frage der Definition. Je nachdem, ob die nun „enger“ oder „weiter“ gefasst werde, falle ein Phänomen darunter oder auch nicht. Und das stimmt definitiv nicht. Denn wenn mit „Rassismus“ etwas gemeint ist, wenn dieser Terminus überhaupt einen Gehalt hat, dann die Vorstellung, es gäbe wertvolle und minderwertige Menschen, und zwar gleich im Kollektiv, also verschiedene Menschensorten, eben die berühmten Rassen. Das ist die eine Bedeutung von Rasse; die andere besteht in der totalen Negation des Individuums. Der Einzelne zählt nur als Exemplar „seiner“ Gattung, er gilt als vollständig determiniert, als festgelegt durch die ihm zugeschriebene Zugehörigkeit zu „seinem“ Kollektiv: „Du bist nichts, dein Volk ist alles“, sozusagen; und alles, was du bist, bist du durch dein Volk! Diese Quasi-Stammeszugehörigkeit ist die wesentliche Eigenschaft und daher auch die völlig hinreichende Information über alle individuellen Exemplare. Damit ist im völkischen Verständnis alles gesagt, über Freund und Feind, loyal und illoyal, gut und böse… und natürlich darüber, was jemandem zusteht und was nicht.
Alle bemühten Versuche, dem durch Umbenennungen zu begegnen – „Roma“ statt „Zigeuner“ etc. –, gehen an der Sache vorbei. Wenn solche Sprachpflege gelingt, werden heute eben Roma diskriminiert: Der italienische Innenminister will sie registrieren, zählen lassen und wenn möglich loswerden. Die „antirassistische“ Sprachkritik ist nicht kritisch, sondern ignorant. Sie nimmt das Offenkundige nicht zur Kenntnis und verharmlost den politisch praktizierten Rassismus zur Respektlosigkeit in Folge leichtfertigen oder auch absichtlich diffamierenden Sprachgebrauchs – so als könnte man durch die Verwendung „bösartiger“ Bezeichnungen quasi einen Aberglauben mit leider negativen praktischen Folgen erzeugen. Das Dogma, das dieser sprachpolizeilichen political correctness zugrunde liegt, ist das von der substantiellen Grundlosigkeit des Rassismus, und das geht eben an der Sache vorbei. Apropos Umbenennungswahn: Warum ist eigentlich noch niemand auf die Idee gekommen, dem Antisemitismus das Wasser abzugraben, indem das Wort „Jude“ durch ein anderes ersetzt wird?
Die Sache ist eben die, dass es sie im richtigen Leben doch gibt, die Wertvollen und die Minderwertigen – fragt sich nur, für wen und warum. Es wäre zum Beispiel interessant zu erfahren, warum Südtiroler, die in den Augen der Regierung einen (österreichisch/italienischen) „Doppelpass“ verdienen, für die ÖVP-FPÖ-Koalition offensichtlich wertvoller sind als Türken, denen ein solcher Pass in Österreich überhaupt nicht zusteht. Das übliche Kriterium des österreichischen Kanzlers für die Wertvollen – bekanntlich die, „die ins System einzahlen“ – gibt die Distinktion in dem Fall sicher nicht her: Die Türken in Österreich zahlen ja, die Südtiroler in Italien nicht. Außerdem stellt sich die Frage an den Alltags-Antirassismus: Welche Bezeichnung sollte man nun besser vermeiden – „Südtiroler“ oder „Türke“?
Durch die gern von Antirassisten verlangte Problematisierung oder gar Ächtung von Bezeichnungen wie „wertvoll“, „minderwertig“ oder „lebensunwert“ ändert sich der betreffende Sachverhalt – Ersaufen-Lassen oder nicht? Doppelpass oder nicht? – jedenfalls in keiner Weise. Denn auch das gehört zum Antirassismus-Diskurs: Der Imperativ „Das darf man so nicht sagen“, also die durch sprachliche Sensibilität zu vollbringende Verharmlosung, Vertuschung oder „Verdrängung“ der Phänomene. So als würden die rassistischen Unterscheidungen erst durch die passenden Bezeichnungen entstehen oder wenigstens gefördert werden. Die Tatsachen als solche gelten als eine Art Tabu, als etwas, das es nicht geben darf und das daher wenigstens totgeschwiegen werden muss, wenn es denn existiert. Es gilt in Österreich als ausgemacht, dass beim Umgang mit der „Vergangenheit“ vieles „verdrängt“ worden sei, bis sich das im Verlauf der „Waldheim-Affäre“ angeblich geändert habe. Nun, die Verdrängung der Gegenwart ist auch nicht von schlechten Eltern!
Für die Wertvollen gibt das österreichische Außenministerium eine Reisewarnung heraus: Afghanistan ist ein gefährliches Land, also sollte man als Österreicher besser draußen bleiben; gewisse Minderwertige werden demgegenüber gegen ihren Willen dorthin verfrachtet. Die Minderwertigen sollen also weniger werden, die Wertvollen sollen sich vermehren; zumindest ist das die Intention einschlägiger Bestimmungen, durch die steuerliche Absetzbarkeit von Kindern deren Produktion anzukurbeln. Im Nachhinein gilt es als profunder Hinweis auf den Irrsinn des Nationalsozialismus, dass damals nützliche Glieder der Gesellschaft aussortiert wurden. Auch heute spricht allerdings erwiesene ökonomische Nützlichkeit etwa von Lehrlingen nicht gegen deren Deportation. Wenn es um die Rasse geht, war der ökonomische Nutzen immer irrelevant, und „Schindlers Liste“ war bekanntlich die Ausnahme von der Regel. Alle Abschiebungen verlaufen natürlich streng nach Recht und Gesetz, denn „Recht muss Recht bleiben“, worauf sich diejenigen als quasi-ohnmächtig berufen, die solche Gesetze machen – und die jede Verordnung über Asylbewerber und Lehrstellen sofort streichen, sobald sie ihnen nicht passt.
Die „Anfänge“ sind längst da: Die Flüchtlinge sind unser Unglück!
„Nun also die ‘Mutter aller politischen Probleme in diesem Land’. Das ist die Migrationsfrage. Sagt Horst Seehofer.“ (Der Spiegel, 6.9.2018) Immerhin verwendet er nicht direkt die Formel von „unserem Unglück“ – wie die antisemitische Parole im 19. Jahrhundert lautete! Dabei ist das der nicht zu übersehende Standpunkt, zu dem sich Europa hinarbeitet oder schon hingearbeitet hat. Wenn Seehofer wortwörtlich so getönt hätte, wäre ihm wohl von sensiblen Publizisten die „Wortwahl“ angekreidet worden. Sein dreimal demokratisch gewählter Kollege Orbán versteht sich ebenfalls auf die unermüdliche Wiederholung von prägnanten Formulierungen und traditionsbewussten Verschwörungstheorien: „Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán hat Ost-Mitteleuropa zur ‚migrantenfreien Zone‘ erklärt. Die EU und einige ihrer wichtigen Mitgliedsstaaten seien von einem nicht näher bezeichneten ‚Spekulanten-Imperium‘ in Geiselhaft genommen worden… Derzeit läuft eine Fragebogen-Aktion der Orbán-Regierung, bei der die Bürger Suggestivfragen zu einem angeblichen ‚Soros-Plan‘ beantworten sollen. Auch dieser bezwecke nach Orbáns Darstellung, Europa mit Flüchtlingen aus Asien und Afrika zu ‚überschwemmen‘, um die ‚christliche und nationale Identität‘ seiner Völker zu zerstören.“ (Kurier, 23.10.2017)
Die Zerstörung der nationalen Identität war übrigens der Haupt- und Kardinalvorwurf Hitlers an „das Judentum“. Es sei „zersetzend“, zerstörend mitten im Deutschtum unterwegs – was nicht länger hinzunehmen sei. So entfaltete die seit den Gründerjahren des Deutschen Reichs kursierende Parole „Die Juden sind unser Unglück“ (siehe: Wikipedia, Eintrag „Heinrich von Treitschke“) ihre Wucht.
November
Fahrverbote – eine Autonation lernt das Gruseln
Fahrverbote, um Grenzwerte einzuhalten – geht das? Darf man das? Ist das noch verhältnismäßig? „In NRW-Behörden“, meldet die Presse (General-Anzeiger, 20.11.18), „wachsen Zweifel an der Zuverlässigkeit vieler Messwerte“. Müssten z.B. die Messstationen nicht da stehen, wo weniger Autos fahren? Dazu ein Kommentar von SuitbertCechura.
Gerichte haben verschiedene Städte dazu verpflichtet, ihre Luftreinhaltungspläne so zu gestalten, dass – unter Einhaltung einer Frist – endlich die gesetzlichen Grenzwerte für die Belastung der Luft an den Messstellen auch wirklich nicht mehr überschritten werden. Was vielen Bürgern als die größte Selbstverständlichkeit gilt, dass man sich an Gesetze zu halten hat, gilt offenbar nicht für die Behörden und die Politik.
Lauter Betroffene
Die Urteile haben in den Medien für große Aufregung gesorgt und gleich eine Menge von Betroffenen hervorgebracht, die nicht etwa unter schlechter Luft leiden, sondern an der Verpflichtung durch die Gerichte, etwas für die Verbesserung der Atemluft zu unternehmen. Deshalb gab es zunächst einmal heftige Gerichtsschelte. Richtern, die darauf bestehen, dass geltende Gesetze auch dann umzusetzen sind, wenn sie dem Geschäftsleben in den Innenstädten schaden, wurde Weltfremdheit bescheinigt. Schließlich gilt es hierzulande als die größte Selbstverständlichkeit, dass für das Wohlergehen der Wirtschaft einige Tausend Tote – wie die EU-Statistiker im Fall der Autoabgase ausgerechnet haben – in Kauf zu nehmen sind.
Als Betroffene wurden auch die Dieselbesitzer ausgemacht, deren Autos nichts mehr wert sind und die nur noch eingeschränkt in die Innenstädte fahren können. Aufregen sollen sie sich nicht über die Unternehmen, die sie beim Kauf ihres Fahrzeugs hinters Licht geführt haben, sondern über das (drohende) Fahrverbot. Dass sie selber auch die verpestete Luft einatmen, ist da kein Thema, sondern schlicht Lebensrealität.
Betroffen von den Fahrverboten – und nicht vom Betrug der Autoindustrie – sind natürlich auch die Handwerker und Gewerbetreibenden, die mit ihren Fahrzeugen die Innenstädte bevölkern. Ihnen wird durch solche Eingriffe ihr Geschäft erschwert bis verunmöglicht, was nicht sein darf, sind die Innenstädte doch der Ort, wo das Geschäftsleben seine Heimat hat, weswegen man über die Qualität der Atemluft dort kein Wort zu verlieren braucht.
Mit Anteilnahme kann die deutsche Autoindustrie rechnen, die natürlich ganz eminent betroffen ist. Ihr Ansehen in der Welt und beim Kunden ist angekratzt – und das ist schlecht fürs Geschäft. Verantwortungsvolle Journalisten rechnen denn auch gleich aus, wie viele Arbeitsplätze durch die (begrenzten) Verbotsmaßnahmen bedroht sind. Für die Meinungsmacher steht es als unverrückbares Faktum fest, dass Arbeitnehmer nur dann ihren Lebensunterhalt verdienen können, wenn sich durch den Einsatz ihrer Arbeitskraft der Reichtum derer vermehren lässt, die über ganz andere Besitzstände verfügen als bloß einen fahrbaren Untersatz, nämlich über maßgebliche Geschäftsanteile an Firmen wie VW, Daimler oder BMW. Dieses Geschäftsinteresse wiegt eben schwerer als der Lebensunterhalt derer, die von ihrer Arbeit leben müssen. Deshalb gibt es auch nichts daran zu kritisieren, dass aus den Betrugsmanövern der Autoindustrie gleich wieder ein neues Geschäft gemacht wird: Sollen doch die Betrogenen sich ein neues Auto kaufen, das weniger Dreck ausstößt!
Was daraus folgt
Kein gutes Zeugnis bekommt die Politik ausgestellt. Sie habe zu wenig für die Vermeidung von Fahrverboten getan, heißt es. Dabei ist Untätigkeit der Politik am wenigsten vorzuwerfen: Sie hat schließlich die Grenzwerte für die Qualität der Atemluft in den Städten so festgelegt, dass die Grenzen nicht unbedingt einzuhalten sind. Sie hat vielmehr gleich die Bestimmung hinzugefügt, dass sie regelmäßig überschritten werden dürfen. Denn eins war den Politikern von Anfang an klar: Zu einer Einschränkung des Geschäftslebens darf die Rücksichtnahme auf die Gesundheit der Bevölkerung nicht werden, für das Wirtschaftswachstum sind eben einige Tausend Tote und Kranke in Kauf zu nehmen.
Für die Einhaltung der Grenzwerte legte die Politik seinerzeit eine Frist fest, in der dies umgesetzt werden sollte. Die Frist lief 2010 ab. Aber untätig war man nicht. Es wurden nicht nur Schilder aufgestellt für Umweltzonen, die keiner kontrolliert, die maßgeblichen Politiker setzten sich auch dafür ein, dass die Umweltbestimmungen nicht zu einer Belastung für die deutsche Autoindustrie ausarteten. Sowohl der Auto-Kanzler von der SPD als auch die Umweltkanzlerin aus der CDU haben in Europa dafür gesorgt, dass die Autoindustrie alle Freiheiten bekam, was die Verschmutzung der Umwelt betrifft: Die Hersteller durften die Einhaltung von Grenzwerten selber kontrollieren und die Werte auf der Straße weit überschreiten; sie bekamen Abschaltvorrichtungen zum Schutz des Motors genehmigt, die bei fast jeder Temperatur wirksam sein durften und heute Schummelsoftware heißen. Bei so vielen Freiheiten ist es daher kein Wunder, dass es so gut wie unmöglich ist, die Hersteller wegen Betrugs zu verklagen – war doch letztlich alles staatlich genehmigt. Auch setzte sich die Politik sofort dafür ein, nachdem die USA den deutschen Firmen das Leben so schwer gemacht hatte, diese mit staatlichen Mittel zu fördern und das Geschäft in Form einer Umweltprämie zu unterstützen.
Und wenn nun doch per Gerichtsurteil die Luftqualität zum Hindernis für das Wirtschaftswachstum werden sollte – was ist da einfacher, als eben die Grenzwerte zu verändern? Ein bisschen mehr Dreck in den Lungen wird dem Geschäft nicht schaden.
Oktober
Betrifft: „Verwaltete Armut“
Im November erscheint im Hamburger VSA-Verlag das von Renate Dillmann und Arian Schiffer-Nasserie verfasste Buch „Der soziale Staat“. Zu dem Vorabdruck, der unter dem Titel „Verwaltete Armut“ in der Tageszeitung Junge Welt erschienen ist, hier eine Anmerkung der IVA-Redaktion.
Das bei IVA bereits für Oktober angekündigte Buch „Der soziale Staat“ von Renate Dillmann und Arian Schiffer-Nasserie (siehe „Armut in einem reichen Land – ein Widerspruch?“, Texte2018, September) wird aus technischen Gründen erst im November erscheinen. Einen Vorabdruck des ersten Teils des Fazits veröffentlichte die Tageszeitung Junge Welt unter dem Titel „Verwaltete Armut“ auf ihrer Themenseite am 5. Oktober 2018 (online: https://www.jungewelt.de/artikel/341086.sozialpolitik-verwaltete-armut.html). Diesem Vorabdruck fügte die JW-Redaktion folgenden Vorspann hinzu: „Auf Notlagen und Missstände reagiert der bürgerliche Staat mit einer Sozialpolitik. Die hat enge Grenzen, denn sie darf die ehernen Prinzipien der Marktwirtschaft nicht gefährden.“
Dass der bürgerliche Staat die „Prinzipien der Marktwirtschaft“ nicht in Frage stellt, ist eine zutreffende Aussage, die man auch in dem besagten Buch findet. Allerdings kann die Formulierung vom Sozialstaat, der auf Missstände – beschränkt und zurückhaltend – reagiert, genau in Richtung eines beliebten Missverständnisses führen, das im Grunde dann doch bei einem Lob dieser Staatsaufgabe landet und das die Autoren von „Der soziale Staat“ gerade ausräumen wollen. Gemeint ist die Vorstellung bzw. (An-)Klage, Sozialpolitik werde nur in „engen Grenzen“ praktiziert, statt dass sie… Wobei dann eine mehr oder weniger elaborierte Liste dessen folgt, was sie alles zu tun hätte, um den sozialen Übeln an die Wurzel zu gehen.
Kapitalismus erscheint auf diese Weise als schlechte Bedingung für den Sozialstaat. Das ist übrigens ein Missverständnis, das seine welthistorische Rolle gespielt hat, nämlich im realen Sozialismus – dessen Sozialpolitik, Marke DDR, in dem Buch auch ein eigenes Kapitel gewidmet wird. In diesem (mittlerweile historischen) Fall wurde ein Staat etabliert, der sich endlich von den besagten Grenzen freimachte und sich ganz den Werktätigen, genauer gesagt: der berühmten „Hauptaufgabe“ widmete, die “Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik“ herzustellen: „Unser Hauptkampffeld ist die Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik. Wir sind dafür, diesen Kurs fortzuführen.“ (Honecker, XI. Parteitag)
Dass der bürgerliche Staat bevor er reagiert, längst agiert hat, somit auch gar nicht auf Grenzen stößt, die ihm eine – irgendwie vorgefundene oder vorgegebene – Marktwirtschaft setzt, ist gerade die Beweisabsicht des neuen Buchs zum Sozialstaat. Deshalb beginnen die Autoren mit einem ökonomischen Grundlagen-Teil, der der Frage nachgeht, welche Prinzipien hier gelten, wer sie in Kraft setzt und aufrecht erhält. Und deshalb endet das Fazit des Buchs auch mit einer zusammenfassenden Kritik am Sozialstaatsidealismus, der sich hartnäckig hält. Da im JW-Vorabdruck der Schlussteil leider weggefallen ist, liefert ihn IVA hiermit nach.
Lohnabhängige: unvollkommene Eigentümer…
In der Analyse der neun Kernbereiche zeigt sich, dass der soziale Staat die Notlagen der Lohnabhängigen als Abweichung vom Idealtypus seiner Besitz- und Staatsbürger begreift: Bürgerliche Eigentümer können sich und ihre Familie durch eigene Leistung und von ihrem Eigentum ernähren; sie können die am Markt verlangten Preise zahlen; sie sorgen für Krankheit und Alter vor und haben finanzielle Rücklagen; sie verfolgen ihr Eigeninteresse, kennen aber neben diesem ein übergeordnetes Allgemeinwohl, die öffentliche Ordnung, an deren Funktionieren sich ihr Eigentum (Steuern) und ihre Freiheit (Rechte & Pflichten) zu relativieren haben; sie akzeptieren diese Einschränkungen als unentbehrliche Bedingungen ihrer Nutzenverfolgung. Den Lohnabhängigen gelingt all das nur mangelhaft. Mit seinen Interventionen will der Sozialstaat sie trotz Eigentumslosigkeit und Lohnabhängigkeit zu nachhaltig funktionsfähigen Teilnehmern seiner Konkurrenzgesellschaft, zu einer Art Erwerbs- und Staatsbürger, wenn auch zweiter Klasse, machen.
Für dieses Ziel etabliert der Staat Ausnahmeregelungen gegenüber den Grundprinzipien, die in seiner Gesellschaft gelten. Im Gegensatz zum allgemeinen Tauschverhältnis der freien Marktwirtschaft gewährt er als Sozialstaat für Bedürftige Geld-, Dienst- und Sachleistungen ohne Gegenleistung (z.B. Wohngeld, BaFöG, Sozialhilfe). Er interveniert (z.B. mit Arbeitszeit- und Arbeitsschutzregelungen) in das aus dem Eigentum abgeleitete Direktionsrecht der Unternehmen und schützt damit die Arbeitskraft vor übermäßiger Zerstörung. Er greift auf das Eigentum der Lohnabhängigen (z.B. mit seinen Sozialversicherungen) zu und finanziert damit das Überleben auch in Lebensphasen, in denen sie ihre Arbeitskraft nicht (mehr) vermarkten können. Er überlässt den Inhalt wichtiger Vertragsabschlüsse nicht der Freiheit der Kontrahenten, sondern schränkt die ökonomische Macht der Eigentümer (z.B. im Arbeitsrecht und Mietrecht) im Interesse einer gewissen Kalkulierbarkeit für die schwächere Seite ein. Er macht Ausnahmen vom Prinzip der rechtlichen Gleichbehandlung (z.B. positive Diskriminierung Behinderter) und verschafft ihnen so einen Nachteilsausgleich, ohne den sie an der Konkurrenz um Lohnarbeit nicht teilnehmen könnten.
Das Bemerkenswerte: Nur als Verstoß gegen die den Kapitalismus konstituierenden Grundrechte und -prinzipien ist es überhaupt möglich, die Lohnabhängigen zu dauerhaften Eigentümern ihrer Arbeitskraft zu machen. Nur so werden sie als Eigentümer ihrer Arbeitskraft zur Konkurrenz am Markt befähigt und als freie und gleiche Sozialrechtssubjekte in die bürgerliche Gesellschaft integriert.
Das hat allerdings drei wichtige Konsequenzen. Die erste: Weil das nur als Verstoß gegen die grundsätzliche Rechnungsweise dieser Gesellschaft geht, gemäß der alles zum Wachstum des privaten Eigentums beitragen muss, haben die Ausnahmen notwendig enge Grenzen. Die sozialstaatlichen Leistungen sind beschränkt, reichen in der Regel nicht aus und bleiben für die Betroffenen unbefriedigend, zum einen, weil sie tendenziell die Benutzung der nationalen Arbeitskraft verteuern und zum anderen, weil sie Integration in die Konkurrenz sein sollen und keinesfalls eine Alternative zu ihr sein dürfen. Sozialpolitik ist deshalb vom Standpunkt der darauf angewiesenen Personenkreise notwendig enttäuschend.
… und Idealisten des sozialen Staats
Zweitens verändert sich mit der sozialpolitischen Befähigung und Verpflichtung der Lohnabhängigen zur Konkurrenz um Bildung, Einkommen, Wohnraum etc. deren Stellung zum bürgerlichen Staat. Indem der soziale Staat die Freiheit und das Eigentum der Lohnabhängigen schützt, sie über die soziale Leistungsgewährung zur Konkurrenz befähigt und zugleich darauf verpflichtet, werden aus staatsfernen Proletariern lohnabhängige Erwerbsbürger, d.h. „Bourgeois zweiter Klasse“, die den Staat als Bedingung ihrer Nutzenverfolgung brauchen. Damit wird er für sie das, was der liberale „Nachtwächterstaat“ für das Besitzbürgertum des 19. Jahrhunderts war: „ihr Gemeinwesen“, „ihr“ Staat. Aus ihrer objektiven Staatsbedürftigkeit geht subjektiv der Wille und die Bereitschaft als „Citoyen“ hervor, die persönliche Nutzenverfolgung gegenüber der Staatsgewalt im Allgemeinen (Steuern & Recht) und den (sozial)politischen Eingriffen im Besonderen unterzuordnen.
In einer dritten Konsequenz entsteht darüber ein „Sozialstaatsidealismus“: Den sozialen Staat nehmen sie vor allem als die Institution wahr, die ihnen im Kampf gegen die (meist überlegenen) Interessen der anderen Marktteilnehmer (Arbeitgeber, Vermieter etc.) zur Seite springt, mit ihren Gesetzen, ihrer Aufsicht und ihren Leistungen. Auf die Sozialpolitik des Staats beziehen sich die vom Lohn abhängigen Teilnehmer der marktwirtschaftlichen Konkurrenz also subjektiv-interessiert. Aus dieser Perspektive der „praktischen Vernunft“ erscheint es ihnen mehr oder weniger irrelevant, was der soziale Staat „an sich“ ist, wollen sie vielmehr wissen, was er „für sie“ und ihr Leben unter den „nun mal“ geltenden Bedingungen bedeutet. Weil sie auf seine rechtlichen und materiellen Leistungen bitter nötig angewiesen sind, idealisieren sie den sozialen Staat im Umkehrschluss fälschlich zu ihrem Mittel. Sie halten den Staat für eine soziale und rechtliche Schutzmacht, die in ihrem Interesse den „rücksichtslosen Kapitalismus“ in eine „soziale Marktwirtschaft“ verwandelt.
Das rächt sich. Weil allen schönen Erwartungen zum Trotz weder der Kapitalismus noch der Sozialstaat objektiv die Bestimmung haben, die Lohnabhängigen gemäß ihren Bedürfnissen zu versorgen (eher schon ist es umgekehrt), bleiben subjektive Enttäuschungen nicht aus. Jedoch bleibt auch der enttäuschte (Sozial-)Staatsidealismus ein Idealismus. Der real-existierende Sozialstaat erscheint darin als schlechte Verwirklichung des vermeintlichen, des „eigentlichen“ Auftrags staatlichen Handelns. Steigende Mieten und niedrige Renten, marode Schulen und ein schikanöses und prekäres Existenzminimum etc. – aus der Perspektive des enttäuschten Sozialstaatsidealisten erscheint das alles als Staatsversagen.
Der Idealismus über den sozialen Staat und die kongeniale Enttäuschung über sein reales Wirken mögen als schlichte theoretische Fehlbestimmung erscheinen. In der deutschen (Sozial)Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts zeigen sich deren ebenso folgenreiche wie verhängnisvolle Konsequenzen. Davon handelt der historische Teil des Buches…
Noch mal: Beutelsbach
Die politische Bildung der BRD gerät in Verruf. Einerseits soll sie seit ewigen Zeiten den rechten Rand kleinmachen, der aber immer größer wird. Andererseits entdeckt die AfD jetzt das Klassenzimmer als einen Hort politischer Indoktrination, der keiner auskommt. Was ist da los? Eine Antwort gibt Johannes Schillo.
Wie IVA berichtete („Gruß aus Beutelsbach“, Texte2018, Oktober), hat die AfD, seitdem sie in Landes- und Kommunalparlamenten vertreten ist, die politische Bildung zu einem besonderen Beobachtungs- und Sorgeobjekt erkoren. In Hamburg startete die AfD-Bürgerschaftsfraktion, nachdem sie vorher schon – wie andere AfD-Landtagsfraktionen auch – mit einschlägigen Anklagen und Beschwerden hervorgetreten war, zum September 2018 ein Online-Portal „Neutrale Schule“ (vgl. Hein 2018). Hier sollen Schüler Lehrkräfte melden, die sich politisch in einer Weise äußern, die der AfD missfällt. Wie man aus der Partei hört, besteht in anderen Bundesländern ebenfalls die Absicht, solche Online-Meldeportale einzurichten; in Baden Württemberg gibt es jetzt z.B. eine Plattform, bei der sich Opfer von „Diskriminierung, Ausgrenzung und Mobbing“ melden können (Junge Welt, 18.10.2018).
In Bayern nannte nach der Landtagswahl die AfD-Spitzenkandidatin Ebner-Steiner drei Schwerpunkte, mit denen die Alternativpartei ihr Engagement in Landesfragen unter Beweis stellen will: erstens Bevorzugung bayerischer und deutscher Bürger beim Wohnungsbau, zweitens – wenig überraschend – eine Korrektur des Länderfinanzausgleichs und schließlich drittens die Förderung „ideologiefreien Lernens“ in den Schulen. Zu Letzterem soll die „Einrichtung eines Beschwerdeportals im Internet“ gehören, „über das sich Schüler, Eltern und Lehrer in Bayern beschweren können, wenn in den Schulen im Unterricht gegen die AfD gehetzt werde.“ Damit will die Partei „die Indoktrination in den Klassenzimmern beenden“, so Ebner-Steiner (FAZ, 16.10.2018).
Beutelsbacher Konsens
In den schulpolitischen und -rechtlichen Debatten, die durch den AfD-Vorstoß ausgelöst wurden, tauchte immer wieder die Bekräftigung der parteipolitischen Neutralität auf, zu der Politiklehrer und -lehrerinnen verpflichtet sind. Dabei wurde meist auch, so von der Kultusministerkonferenz (KMK), Bezug auf den so genannten Beutelsbacher Konsens genommen, der 1976/77 formuliert wurde und mit dem seinerzeit linke Ansprüche auf eine Kritikfunktion der politischen Bildung zurückgewiesen werden sollten (zu den Einzelheiten siehe Ahlheim 2012). Die KMK legte bei ihrer Sitzung am 11./12. Oktober 2018 überarbeitete Empfehlungen zur Demokratiebildung vor, die auch auf Beutelsbach zu sprechen kamen: „Eine zentrale Grundlage demokratischen Lernens ist die schulpraktische Anwendung des Beutelsbacher Konsenses. Neben dem Überwältigungsverbot und der Subjektorientierung enthält er auch das Kontroversitätsgebot: ‚Was in Wissenschaft und Politik kontrovers ist, muss auch im Unterricht kontrovers erscheinen.‘ Diese Forderung ist mit der Notwendigkeit demokratischen Lernens aufs engste verknüpft, denn wenn unterschiedliche Standpunkte unter den Tisch fallen, Optionen unterschlagen werden, Alternativen unerörtert bleiben, ist der Weg zur Indoktrination beschritten.“ (KMK 2018, 4f)
Wie im letzten IVA-Beitrag zu Beutelsbach erläutert, heißt das natürlich nicht, dass alle möglichen Kritikpunkte zur Sprache gebracht und im Unterricht ernsthaft diskutiert werden könnten. Die KMK stellt das mit einer Erläuterung noch einmal klar: „Dies bedeutet nicht, dass jede Position akzeptiert werden muss oder alle Positionen in gleicher Weise gelten. Wenn Schülerinnen und Schüler in einer Diskussion Standpunkte äußern, die mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung und den Menschenrechten nicht vereinbar sind, dürfen Lehrerinnen und Lehrer diese keinesfalls unkommentiert oder unreflektiert lassen.“ (Ebd., 5) Der vorgegebene Rahmen der politisch akzeptierten Kontroversen definiert den Pluralismus, der im Unterricht Platz hat, wobei dem Ganzen schon die unbedingte Verpflichtung auf die freiheitlich-demokratische Grundordnung vorausgesetzt ist. Diese Verpflichtung schließt die gesellschaftliche Ordnung, also die hiesige Marktwirtschaft ein, was ebenfalls von der KMK eigens hervorgehoben wird. Die Schüler sollen nämlich „so früh wie möglich an die Grundprinzipien unserer demokratischen Staats- und Gesellschaftsordnung herangeführt und mit ihnen vertraut gemacht werden“ (ebd.), d.h. eben auch mit einer Privateigentumsordnung, in der die Einzelnen im freien Wettbewerb die Chancen eines Erwerbslebens ergreifen, das im Gelderwerb – wirtschaftspolitisch formuliert: im Wachstum – sein Maß und Ziel hat. Im Weiteren kommen zu den „Grundprinzipien“, die als Elemente einer Werteordnung eingeführt werden, die also unbedingt verpflichtenden Charakter haben, Präzisierungen hinzu, die gegen eventuelle Missverständnisse noch einmal darlegen, wo die Grenze zwischen zulässigen und ausgegrenzten Positionen verläuft. Zu den unbedingt zu achtenden Menschenrechten und Grundwerten gehören z.B auch „zentrale EU-Normierungen“ (ebd., 8), die bekanntlich das gesamteuropäische Aufrüstungsgebot oder die Gewährleistung eines freien Wettbewerbs auf dem EU-Binnenmarkt einschließen. Nicht dazu gehört natürlich der „politische Extremismus“ (ebd., 9). Dessen Reichweite wird hierzulande in wesentlichen Teilen durch eine Behörde bestimmt, deren letzter Chef im polizeilichen Niederknüppeln einer Anti-G20-Demonstration eine Art Bürgerkriegsfall sah, während er bei Chemnitzer Attacken auf Ausländer keine „Hetzjagden“ erkennen konnte.
Indoktrination & Überwältigung
Die AfD hat sich in ihren programmatischen bildungspolitischen Äußerungen auch zum Beutelsbacher Konsens bekannt (vgl. Schillo 2017). Ihr Einspruch gegen den bundesrepublikanischen Bildungsbetrieb beruft sich vor allem auf das erste Beutelsbacher Prinzip, auf das „Überwältigungsverbot“. Es setzt schulische (und damit grundsätzlich auch außerschulische) Bildungsanstrengungen in Gegensatz zur „Indoktrination“. Diese ist laut Duden die, gegebenenfalls massive, „psychologische Mittel nutzende Beeinflussung von Einzelnen oder ganzen Gruppen der Gesellschaft im Hinblick auf die Bildung einer bestimmten Meinung oder Einstellung“. Mit den „psychologischen Mitteln“ wird auf Verfahrensweisen angespielt, die, mit dem Etikett „Manipulation“ versehen, im Grunde das Ideal aller (partei-)politischen oder (markt-)wirtschaftlichen Werbemaßnahmen darstellen: die möglichst unauffällige Einflussnahme auf den Willen von Menschen unter Umgehung ihrer bewussten Kontrolle. Auch wenn neuerdings besonders russischen Hackern diese geheimnisvolle Potenz zugeschrieben wird, Bewusstsein, z.B. in Wahlkämpfen, zu bilden, ohne dass die Betreffenden sich die Inhalte bewusst zu eigen machen, handelt es sich hier um ein ideologisches Konstrukt. Es drückt nur die Zielsetzung von Sozialtechnologien aus, Menschen in ihrem Verhalten zu steuern, ohne eine mühsame Überzeugungsarbeit zu leisten. Und es wird abwertend benutzt, um anderen eine unzulässige Einflussnahme vorzuwerfen. Dasselbe gilt für „Indoktrination“.
Deren grundsätzliche Verfehlung soll darin bestehen, dass sie eine bestimmte Meinung oder Einstellung zum Ziel hat, statt freie Rede und Gegenrede zuzulassen und eigenständige Meinungsbildung zu ermöglichen. Das Klassenzimmer darf laut AfD kein Ort der Indoktrination sein, jedoch werde „an deutschen Schulen oft nicht die Bildung einer eigenen Meinung gefördert, sondern die unkritische Übernahme ideologischer Vorgaben. Ziel der schulischen Bildung muss jedoch der eigenverantwortlich denkende Bürger sein.“ (AfD 2016, 54) So heißt es im AfD-Grundsatzprogramm und dies ist auch der Tenor der Anklagen, die die Partei gegen den Schulalltag oder gegen außerschulische Projekte richtet. In der abstrakten Standortbestimmung – gegen Überwältigung – stimmen also politikdidaktischer und parteipolitischer Mainstream, Behörden, Richtlinien und Verbände, rechte und liberale Positionen überein. Was ist von diesem breitesten Konsens zu halten? Ist er selbstverständlich?
Auf keinen Fall! Als Erstes wäre daran zu erinnern, dass, wie die KMK-Empfehlungen mustergültig darlegen, natürlich in der Schule tagein, tagaus indoktriniert wird. Die Festlegung auf Grundwerte und Grundordnung gilt für den Unterricht als absolute Verpflichtung. Sie stehen nicht zur Disposition. Die bundesdeutsche Demokratie ist nicht nur als eine Herrschaftsform bekannt und zum Diskussionsgegenstand zu machen, sondern die Grundlage, auf der sich alles weitere Meinen und Meinungen-Austauschen zu vollziehen hat. Demokratie, das machen die KMK-Empfehlungen an einer langen Liste von Maßnahmen deutlich, soll in der Schule eingeübt, erfahren, gelebt werden. Sie soll ins Gefühl übergehen, verinnerlicht werden – möglicher Weise sogar durch Anleihen bei manipulativen Techniken, die von einigen Pädagogen mehr geschätzt werden als „verkopfte“ Ansätze rationaler Auseinandersetzung.
Eine Sternstunde der Thematisierung des pädagogischen Indoktrinationsbedarfs war übrigens die Wendezeit in Deutschland 1990ff, als sich DDR-Pädagogen und Pädagoginnen auf den demokratischen Erziehungsauftrag umstellen mussten. Der Erziehungswissenschaftler Huisken hat im ersten Band seiner „Kritik der Erziehung“ diesen Umstellungsprozess kommentiert (Huisken 1991, 278ff). „Erziehung statt Indoktrination“ hieß dessen Losung. Das Lehrpersonal musste in diversen Umschulungsmaßnahmen lernen, den Primat der Politik – die Erziehung zur sozialistischen Persönlichkeit – aufzugeben und statt dessen den zu erziehenden Menschen mit seiner Würde in den Mittelpunkt zu stellen, also von dem einen Leitbild zum andern wechseln. Das galt als Schritt der Entpolitisierung: Indoktrination wird beendet, eine ideologiefreie Erziehung beginnt. „Praktisch gilt natürlich auch im Kapitalismus besagter Primat der Politik, der mit Schulgesetzen und Lehrplan dem Nachwuchs die Richtung weist. Aber betrachtet gehört die Sache in aller Freiheit anders, nämlich andersherum. Staatliche Nachwuchsproduktion ist im Lichte der demokratischen Pädagogik ein Dienst am Kind, der in aller Uneigennützigkeit die Maßstäbe seiner Dienstleistung dem Objekt entnommen haben will, auf das sie Anwendung finden.“ (Huisken 1991, 279)
Zweitens ist daran zu erinnern, dass mit dem Anspruch, Demokratie solle der Jugend gewissermaßen in Fleisch und Blut übergehen, natürlich eine aktive Rolle gemeint ist, pädagogisch formuliert: auf Kompetenzen gezielt wird. Die nachwachsenden Staatsbürger sollen sich im Rahmen ihrer Rechte und Pflichten betätigen und nicht zu Konsumenten einer Zuschauerdemokratie werden – zu politischen Statisten, die noch nicht einmal bereit sind, ihren zivilgesellschaftlichen Beitrag zum Gemeinwesen zu leisten. Insofern ist natürlich Überwältigung der Adressaten, die deren passive Unterordnung hervorbringt, vielleicht sogar Gleichgültigkeit und Unmut erzeugt, nicht zielführend. Staatsbürger, die als selbstbewusste Patrioten agieren, sind gefragt. Dass dem Schulbetrieb übrigens ein Überwältigungsverbot vorgeschrieben werden muss, zeigt gleichzeitig, dass das bürgerliche Gewaltverhältnis namens Erziehung diese Option durchaus einschließt. Es hat schon – wie vor 50 Jahren mit „1968“ losgetreten – eine antiautoritäre Revolte gebraucht, um den Schulverantwortlichen klarzumachen, dass Demokratie im Volksbewusstsein besser dadurch verankert wird, dass man sie „lebt“, als wenn sie von Paukern dem Schülermaterial – von oben – eingebläut wird. Es ist ein Kuriosum, dass die AfD, die den Geist von 1968 ausrotten will, sich gerade auf diese pädagogische Innovation der 68er beruft!
Drittens ist, wie oben dargelegt, mit dieser Verpflichtung auf die Grundordnung in Staat und Gesellschaft gleich klargestellt, wie der Diskurs, in dem Meinung auf Gegenmeinung stößt und in dem das Lehrpersonal eine Art Moderator in hoheitlichem Auftrag darstellen soll, gemeint ist. Alle zugelassenen Meinungen haben sich aneinander zu relativieren – im Rahmen und nach Maßgabe der demokratischen Ordnung, die die verbindlichen Festlegungen bestimmt, von den unverhandelbaren Grundrechten und Grundwerten bis zu den alternativlosen Notwendigkeiten und Herausforderungen, die ein Standort im Globalisierungszeitalter kennt.
Erst an dieser Stelle setzt die AfD mit einem Dissens an, indem sie einige der bisher als alternativlos geltenden Herausforderungen etwas anders akzentuiert – und solange der Verfassungsschutz sie nicht auf die Beobachtungsliste setzt, hat sie alles Recht, mit alternativdeutschen Vorschlägen im Unterricht vorzukommen. Was sie bildungspolitisch in den Betrieb einbringen würde, ist einerseits nichts Neues (vgl. Schillo 2017). Sie würde die Abwehr aller linken bis linksradikalen Ideen, die sowieso zur Bildungsarbeit dazugehört, fortsetzen. Sie würde so natürlich beim Thema Extremismus deutlichere Akzente setzen, wobei sie sich ganz bequem auf Vorarbeiten eines sozialdemokratischen Bürgermeisters Scholz oder eines Verfassungsschutz-Präsidenten Maaßen stützen könnte. Auch bei der „Renovierung“ der Erinnerungskultur, die schon länger ein seriöses Thema bei Fachleuten und fördernden Stellen ist, würde sie Änderungen auf den Weg bringen. Wenn Butterwegge und Co. zur Geschichtspolitik der AfD schreiben „Nicht die Umdeutung des Faschismus, sondern sein Verschwinden aus der Öffentlichkeit wird angestrebt“ (Butterwegge u.a. 2018, 119), dann trifft das insofern zu, als es einen nationalen Konsens wiedergibt, der sich in Deutschland mit dem Ende des 20. Jahrhunderts herausgebildet hat und demzufolge nicht mehr die Schandtaten der NS-Zeit der Bezugspunkt des Nationalbewusstseins sind, sondern die geläuterte Nation.
Andererseits aber würde das doch einschneidende Folgen haben, weil es diesen nach rechts verschobenen Konsens eben weiter verschieben würde. Im Blick auf interkulturelle Bildung und Begegnung, auf Themen wie Migration/Integration und Gender, bei der Kritik von Rassismus und Nationalismus würden dann wohl ganze Abteilungen zurückgebaut oder stillgelegt. Das wären die unmittelbaren pädagogischen Konsequenzen. Entscheidend ist aber, dass so der Zeitgeist, dem die AfD jetzt mit einer groß dimensionierten „Desiderius-Erasmus-Stiftung“ und anderen Aktivitäten auf die Sprünge helfen will (vgl. v. Olberg 2018, Hafeneger 2018), nur noch in der feindlichen Stellung gegenüber dem Ausland und den Ausländern sein Lebenselixier hätte.
Nachweise
- AfD, Programm für Deutschland – Das Grundsatzprogramm. Beschluss vom Bundesparteitag, 30.4./1.5.2016, online: www.alternativefuer.de/programm (16.2.2017).
- Klaus Ahlheim, Die „weiße Flagge gehißt“? Wirkung und Grenzen des Beutelsbacher Konsenses. In: Klaus Ahlheim/Johannes Schillo, Politische Bildung zwischen Formierung und Aufklärung, Hannover 2012, S. 75-92.
- Christoph Butterwegge/Gudrun Hentges/Gerd Wiegel, Rechtspopulisten im Parlament – Polemik, Agitation und Propaganda der AfD. Frankfurt/M. 2018.
- Benno Hafeneger, „Der Bildungsbereich wird zunehmend ein Handlungsfeld der AfD werden“. Interview. In: dis.kurs, Nr. 3, 2018, S. 4-6.
- Franziska Hein, AfD-Meldeportale – Juristen sehen keine dienstrechtlichen Folgen. In: MiGAZIN, 12.10.2018, online: http://www.migazin.de/2018/10/12/afd-meldeportale-juristen-sehen-keine-dienstrechtlichen-folgen/.
- Freerk Huisken, Die Wissenschaft von der Erziehung – Einführung in die Grundlügen der Pädagogik. Hamburg 1991.
- KMK – Kultusministerkonferenz, Demokratie als Ziel, Gegenstand und Praxis historisch-politischer Bildung und Erziehung in der Schule. KMK-Beschluss vom 6.3.2009 in der Fassung vom 11.10.2018.
- Hans-Joachim von Olberg, Der Bock wird Gärtner: Desiderius-Erasmus-Stiftung der AfD. In: Polis, Nr. 3, 2018, S. 4-5.
- Johannes Schillo, Für einen schwarzrotgoldenen Schlussstrich – AfD und politische Bildung. In: Außerschulische Bildung, Nr. 2, 2017, S. 51-57, online: https://www.adb.de/download/publikationen/AB_2-2017_Beitrag_Jahresthema_Johannes_Schillo.pdf.
„Gruß aus Beutelsbach“
So hieß es am 12.10.2018 auf Seite eins der FAZ. Aus Anlass der AfD-Aktivitäten zur Überwachung des Politikunterrichts erinnerte das Blatt an den „Beutelsbacher Konsens“ der Politikdidaktik, mit dem vor fast einem halben Jahrhundert einer kritischen politischen Bildung die Spitze abgebrochen werden sollte. Dazu ein Kommentar von Johannes Schillo.
Seitdem die AfD in Landesparlamenten vertreten ist, widmet sie besondere Aufmerksamkeit der politischen Bildung, etwa dem Politikunterricht und der Art und Weise, wie dort der „Kampf gegen rechts“ oder die Programmatik rechter Parteien behandelt werden (vgl. Schillo 2017, 2018a). Dabei denunziert sie linke „Extremisten“, greift aber auch staatlich approbiertes Unterrichtsmaterial an, weil es den Ansprüchen der Partei auf Selbstdarstellung nicht genügt. In Hamburg hat die AfD-Bürgerschaftsfraktion zum September 2018 ein Online-Portal mit dem Titel „Neutrale Schule“ geschaltet (vgl. Hein 2018). Hier können Schüler Lehrkräfte melden, die sich politisch in einer Weise äußern, die der AfD missfällt. In Brandenburg, Berlin, Sachsen und Baden-Württemberg sollen ähnliche Plattformen folgen, auch weitere AfD-Fraktionen ziehen anscheinend solche Online-Meldeportale in Erwägung.
Als eine „Aufforderung zum Petzen“ (FAZ, 4.10.2018) wurde das in der Öffentlichkeit bewertet. Die SPD-Justizministerin Barley sprach von „organisierter Denunziation“; die GEW forderte ihre Mitglieder auf, sich davon nicht einschüchtern zu lassen, sondern notfalls mithilfe der neuen Datenschutzgrundverordnung gegen Meldungen vorzugehen (FAZ, 12.10.2018). Die Kultusministerkonferenz (KMK) befasste sich auf ihrer Tagung am 11./12. Oktober ebenfalls mit den AfD-Meldeplattformen. Der KMK-Vorsitzende Holter (Linke) erklärte: „Aus aktuellem Anlass wenden wir uns entschieden gegen Internetportale, in denen Schülerinnen und Schüler ihre Lehrkräfte wegen vermeintlicher parteipolitischer Einflussnahme denunzieren sollen. Das führt im Ergebnis zu einer Vergiftung des Schulklimas. Wir sehen es vielmehr als eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe an, Lehrkräfte in ihrem Bemühen zur Demokratiebildung, der Erziehung zu Menschenrechten und im Eintreten für Toleranz, Respekt und Mitmenschlichkeit im Sinne des Grundgesetzes zu unterstützen“. (www.kmk.org, 11.10.2018)
Bei der KMK-Tagung war auch die (parteipolitische) Neutralität, zu der Lehrer im Unterricht verpflichtet sind und die die AfD vermisst, Diskussionsthema. „Die KMK wiederholte einen Satz aus dem Beutelsbacher Konsens, der immer noch Geltung hat: ‚Was in Wissenschaft und Politik kontrovers ist, muss auch im Unterricht kontrovers erscheinen‘.“ (FAZ, 12.10.2018) Der Konsens (dokumentiert in Schiele/Schneider 1996, 226f), der als informelle Übereinkunft von Wissenschaftlern und Bildungsverantwortlichen 1977 formuliert wurde, enthält als Erstes ein „Überwältigungsverbot“, das „Indoktrination“ aus dem Unterricht verbannt (falls sie, muss man ergänzen, über die Festlegung auf den demokratischen Wertekanon hinausgeht). Als Zweites folgt das genannte „Kontroversitätsgebot“, als Drittes das Prinzip, dass Schüler und Schülerinnen in die Lage versetzt werden sollen, eine „politische Situation“ und die „eigene Interessenlage zu analysieren“, um daraus Fähigkeiten zur Teilhabe zu entwickeln.
Konsens gegen links
Übrigens bekennt sich auch die AfD zu Beutelsbach. Was die Bundespartei programmatisch zur politischen Bildung in der Schule äußert, könnte aus den üblichen Richtlinien abgeschrieben sein oder variiert den Beutelsbacher Konsens. Das Klassenzimmer dürfe kein Ort der Indoktrination sein, heißt es im Parteiprogramm, aber an deutschen Schulen würde „oft nicht die Bildung einer eigenen Meinung gefördert, sondern die unkritische Übernahme ideologischer Vorgaben. Ziel der schulischen Bildung muss jedoch der eigenverantwortlich denkende Bürger sein“ (vgl. Schillo 2017). Mit der Rede von den ideologischen Vorgaben zielt die AfD auf eine kulturelle Hegemonie der Linken, die angeblich mit „1968“ begann und die man heute immer noch in der Schule antreffen soll. Auch wenn die 68er mehrheitlich ihren Ideen abgeschworen haben, heute meist in Rente sind und von „Systemveränderung“ kaum noch die Rede ist, am allerwenigsten im staatlichen Ausbildungswesen, hat diese Kampfansage gegen links eine gewisse Logik. Sie trifft sich nämlich bestens mit dem Zeitgeist und mit dem Geist von Beutelsbach. Ersterer steht ja heute rechts, wie CSU-Dobrindt Anfang des Jahres in seinem konservativen Manifest formulierte: „Auf die linke Revolution der Eliten folgt eine konservative Revolution der Bürger. Wir unterstützen diese Revolution und sind ihre Stimme in der Politik.“ (FAZ, 9.1.2018) Und hier muss man der CSU konzedieren, dass ihr Kampf gegen linke Strömungen in der Pädagogik kein Nachäffen von AfD-Positionen ist, sondern beste bundesdeutsche Tradition bei der Begradigung bildungspolitischer Aufbrüche seit den 1960er Jahren, als reformerischer Nachholbedarf diagnostiziert wurde („Bildungskatastrophe“). Heute kann sich die wiedervereinigte Nation, die derart viel „Verantwortung“ auf dem Globus übernehmen muss, Bedenklichkeiten in Sachen Machtentfaltung – die ja immer im Betrieb der NS-„Vergangenheitsbewältigung“ mitschwangen – auch mal schenken. Mit umstürzlerischer Attitüde setzen die Konservativen das alte, relativierte Bekenntnis zur eigenen Nation („Verfassungspatriotismus“) außer Kraft. Wir leben schließlich im „besten Deutschland, das es je gab“ (Gauck und tutti quanti), das deshalb konstruktive Nationalerziehung und nicht dauernde Infragestellung verdient.
Das war früher schon mal anders. Es gab in der Tat nach 1968 die (kurzfristige) Illusion, der Beruf des Pädagogen würde Raum für „gesellschaftsverändernde“ Praxis lassen, ja diese geradezu erfordern. Der Erziehungswissenschaftler Huisken hat die einschlägigen Ideen vor Jahren einer Kritik unterzogen, aber auch festgehalten, dass dem damaligen Aufbruch das konservative Roll back auf dem Fuße folgte (Huisken 1991, 172ff; vgl. Eierdanz 2012, 40ff). Als erste, einschneidende bürokratische Maßnahme kam 1972 der Radikalenerlass unterm SPD-Kanzler Willy Brandt, womit klargestellt wurde, wie das sozialdemokratische Motto „Mehr Demokratie wagen“ zu verstehen war: auf keinen Fall als eine Lizenz zur Systemkritik! Andernfalls gab es Berufsverbote. In der schulischen politischen Bildung, wo etwa Hessische Rahmenrichtlinien „konfliktpädagogische“ Elemente und ähnliche „emanzipatorische“ Ideen in die Staatsbürgerkunde einführen wollten, musste auch eine Grenze gezogen werden. Es galt zu klären, was als link(sliberal)e Bereicherung der Diskurskultur zuzulassen und als ideologische Indoktrination auszuschließen war. Hier wurde nach einer Fachtagung von 1976, die das konservative Lager als „pragmatische Wende“ und als Kapitulation der Linken feierte, der Beutelsbacher Konsens formuliert. Ein Jahr später folgte das konservative Manifest „Mut zur Erziehung“, das kategorisch die Ideen gesellschaftlicher Befreiung durch Bildung verwarf und die „Tugenden des Fleißes, der Disziplin und der Ordnung“ hochleben ließ.
Praktisch wurde das in den 1980er Jahren im Rahmen von Qualifizierungsoffensiven durchgesetzt, indem die Tugenden in „Kompetenzen“ umbenannt und durch moderne Varianten wie Flexibilität und Resilienz ergänzt wurden. Mit der neuen, übergeordneten bildungspolitischen Zielsetzung der „Employability“ wurde dann Systemkritik, deren pädagogische Parteigänger schon länger abgedankt hatten, ganz praktisch obsolet: Praxisorientierung, also der Bedarf des Arbeitsmarktes zählte. Zusätzlich gab es die ironische Pointe, dass der neue Bedarf nach Anpassung in einer postindustriellen Wissens- oder Was-auch-immer-Gesellschaft als Einlösung alter emanzipatorischer Ideale verkauft wurde. Das „selbst gesteuerte Individuum“, der Arbeitnehmer als „Unternehmer seiner Arbeitskraft“, wurde zum Leitbild eines aus Eigenverantwortung handelnden Menschen, der nur die Sachzwänge des Marktes gelten lässt, sich aber keine „ideologischen“ Urteile über diese Welt anzutun braucht.
Im Blick auf den politischen Bildungsbetrieb kann man also festhalten, dass es ungerecht ist, die AfD dauernd als das Original und die CSU als ihre Kopie zu bezeichnen, wie zuletzt im bayerischen Wahlkampf geschehen. Die AfD plappert vielmehr die Sprüche nach, mit denen die Formierung dieser Bildungsabteilung – in der sich gelegentlich ein gewisser demokratieidealistischer Überschuss bemerkbar macht – betrieben wird, d.h. ihre Einrichtung als funktioneller Beitrag zur Aufrechterhaltung des demokratischen Kapitalismus, als Imprägnierung des Staatsbürgerbewusstseins gegen Fundamentalopposition. Die AfD ist Teil des herrschenden bildungspolitischen Konsenses, auch wenn sie als Newcomer-Partei Schwierigkeiten hat, sich im etablierten Pluralismus zu behaupten, und die Ungerechtigkeit einer Ausgrenzung, die sie bei anderen, „extremistischen“ Positionen voll unterstützt, zu spüren bekommt. Letzteres ist der Preis dafür, dass sie mit einer fundamentaloppositionellen Rolle kokettiert und sich als Anwalt des kleinen Mannes gegen das Establishment aufspielt.
Kontroversität & Neutralität
Vom etablierten Pluralismus und seinen Grenzen handelt das besagte Kontroversitätsgebot, das gleichzeitig für den schulischen Bereich – für die außerschulische Bildung hatte es eine indirekte Wirkung – das Verständnis von Neutralität des Lehrpersonals definiert. Soweit Positionen in Politik und Wissenschaft kontrovers sind, solange sie also nicht als exzentrisch, soll heißen: „extremistisch“ oder „fundamentalistisch“, ausgegrenzt sind, können sie ihren Platz im Unterricht finden. Pädagoge und Pädagogin dürfen in diesem Rahmen auch einen politischen Standpunkt erkennen lassen, eine schlicht „neutrale“ Position zum demokratischen Betrieb, der ja gerade Wahl- und sonstige Beteiligung, z.B. im Ehrenamt, haben will, ist nicht erwünscht. Die Schüler sollen schließlich die politische Situation von ihrer Interessenlage aus beurteilen lernen, damit sie wissen, wo ein Wahlkreuz hingehört. Den Sinn eines solchen Handelns müssen Lehrkräfte überzeugend rüberbringen. Indoktrinieren, also den eigenen Standpunkt begründen und damit auf die Überzeugungen der Schüler einwirken, dürfen sie aber nicht. Das fällt unter „Überwältigung“ – auch eine verschämte Erinnerung daran, dass man es in der Schule wie im ganzen Erziehungswesen mit Gewaltverhältnissen zu tun hat!
Was kontrovers ist, kann also durchaus Thema einer pädagogischen Auseinandersetzung werden. Was aber, wenn einzelne Themen oder Theorien der Kontroverse faktisch entzogen sind? Wenn immer mehr Vorgänge – von der Globalisierung bis zur Digitalisierung, von der ultimativen Notwendigkeit, Arbeitsplätze zu schaffen und unrentable abzuschaffen, bis zur unvermeidlichen Symbiose von Ökologie und Ökonomie – als „alternativlos“ gelten? Wenn z.B., wie der Erziehungswissenschaftler Ahlheim (2012, 86ff) betonte, die „soziale Frage“ ganz aus dem Blickfeld verschwunden ist, weil sie am Standort D als gelöst gilt oder nur noch als nationale Frage verhandelt wird? Hier hat die Kontroverse ihr Recht verloren; hier begibt sich Bildungsarbeit rasch auf vermintes Gelände, übrigens auch dann, wenn sie ganz systemkonforme Ziele verfolgt, z.B. beim „Kampf gegen rechts“. Falls sie diesen Kampf nämlich so führt, dass sie eine faschistische Gefahr ausmacht, deren Wurzeln im herrschenden Kapitalismus liegen, also mehr Kampf erfordern, als in den Ausgrenzungsstrategien des Extremismuskonzepts vorgesehen ist, wird ihr das staatliche Placet entzogen und daraus ein Fall für den Verfassungsschutz. Um das klarzustellen, wurde mit dem Aufschwung der einschlägigen Programme auch eine „Extremismusklausel“ beschlossen, die die Grenze des Zulässigen zog (vgl. Hafeneger 2012).
Die AfD meldet nicht nur Verstöße, sie ist auch ganz konstruktiv an politischer Bildung interessiert. Die Partei will ja in einem volkspädagogischen Kraftakt eine Fehlentwicklung korrigieren, die durch die linke Hegemonie eingerissen und unter Merkel, speziell ihrer Flüchtlingspolitik, vollendet worden sei: Große Teile des Volkes sind sich ihrer eigentlichen völkischen Qualität nicht bewusst, heißen wildfremde Notleidende willkommen und wollen nicht sehen, dass eine „feindliche Übernahme“ (Sarrazin, SPD) oder eine „irreversible Umvolkung“ (Boehringer, AfD) durch islamische Horden unterwegs ist; statt dessen lassen sie sich wegen gerade einmal 12 dunklen Jahren NS-Zeit – einem „Vogelschiss“ (Gauland) in der mehr als 1000jährigen deutschen Geschichte – von einem „Schuldkult“ beeindrucken, den nicht nur der Rechtsaußen Höcke mit einer 180-Grad-Wende der Erinnerungskultur kontern will. Auch das übrigens Positionen, wie man sie aus den Debatten um die „Renovierung der Erinnerungskultur“ längst kennt!
An die Übereinstimmung mit dem konservativen (Zeit-)Geist muss man auch erinnern, wenn jetzt von verschiedenen Seiten die Etablierung der AfD-nahen „Desiderius-Erasmus-Stiftung“ als besorgniserregendes „bizarres“ Projekt dargestellt wird (vgl. Schillo 2018b). Im Blick auf den Mainstream politischer Bildung und Kultur ist leider festzuhalten, dass das Erasmus-Projekt durchaus stromlinienförmig angelegt ist, was das eigentlich Besorgniserregende an diesem polit-pädagogischen Aufbruch ausmacht! Der entscheidende Punkt ist, dass die AfD auf dem neuen deutschen Nationalstolz und -bewusstsein aufbaut und so der Hauptprofiteur der Merkel-Jahre ist: Wenn der Deutsche schon erhobenen Hauptes vor die Völkerfamilie tritt, darf die nationale Gewissenserforschung auch mal wieder zurückstehen. Dann bekennt man sich eben zur Nation als Höchstwert. Und für diese Aufgabe, die damit doch einen folgenreichen Schritt weitergeht, will die AfD ihre Stiftung mit ihrem groß angelegten Bildungsprogramm einsetzen. Sie braucht ein Instrument, um das Volk zu formieren, denn es ist ja in seinem faktischen Zustand nicht das, was der AfD vorschwebt. Es muss auf den Wert Deutschtum ohne jede Relativierung verpflichtet werden.
„Politische Bildung ist unser Kernanliegen“, heißt es auf der Erasmus-Website (erasmus-stiftung.de), wobei der Stiftung besonders die „staatsbürgerliche Bildungsarbeit“ am Herzen liegt. Letzteres ist (vgl. v. Olberg 2018) nicht nur eine Reminiszenz an die beginnende Staatsbürgerkunde zur Zeit des Eisernen Kanzlers Bismarck, den man in der AfD überhaupt schätzt, sondern – wie im Erlass der Bundeszentrale für politische Bildung noch bis 2000 formuliert – eine Beschränkung auf die wirklichen Volksangehörigen, auf diejenigen, die die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen. Und auf die kommt es der AfD ja an.
Das wuchtige Steuerungsinstrument „Politische Bildung“ muss sie dafür in die eigenen Hände bekommen. Daher auch ihr besonderes Engagement, auf Landesebene Schulen, Politikunterricht und unliebsame Lehrkräfte ins Visier oder auf kommunaler Ebene, wie zuletzt der Erziehungswissenschaftler Hafeneger (2018) herausgestellt hat, Einfluss auf Bildungsprogramme etwa von Volkshochschulen oder in der Jugendarbeit zu nehmen. Angriffspunkte der Alternativ-Deutschen sind dabei vor allem die Themenfelder Migration/Integration, Kampf gegen rechts und deutsche Erinnerungskultur – wo die bestehenden Leitbilder umgepolt werden sollen. Die Streichung von Mitteln, die Verweigerung von öffentlichen Räumen, die Entfernung linker „Extremisten“ sind für die AfD‘ler dann probate Mittel! Darin sind sie gelehrige Demokraten, die natürlich extremistischen Positionen keinen Platz im Feld der Kontroversität lassen.
Dass die Kontrolle der (politischen) Bildungspraxis Ausweis einer totalitären Einstellung sein soll, ist also nicht die Wahrheit. Wenn KMK-Chef Holter erklärt, die Idee der Meldeportale erinnere „an das dunkelste Kapitel deutscher Geschichte. Gerade für die Menschen in Ostdeutschland ist das ein No-Go, denn sie haben sich 1989 von Überwachung und Denunziation befreit“ (FAZ, 12.10.2018), dann erlebt man zudem die Überraschung, dass ein Linkspolitiker den deutschnationalen Tiefpunkt vom NS- auf das SED-Regime verschiebt. Auch eine Variante, aus den bekannten 12 dunklen Jahren eine Art Vogelschiss zu machen!
Nachweise
- Klaus Ahlheim, Die „weiße Flagge gehißt“? Wirkung und Grenzen des Beutelsbacher Konsenses. In: Klaus Ahlheim/Johannes Schillo, Politische Bildung zwischen Formierung und Aufklärung, Hannover 2012, S. 75-92.
- Jürgen Eierdanz, Formierung – Kritik – Affirmation: Politische Bildung zwischen 1950 und 1980. In: Ahlheim/Schillo, Politische Bildung zwischen Formierung und Aufklärung, 2012, S. 11-47.
- Benno Hafeneger, Neue förderungspolitische Direktiven: Extremismusklausel und Extremismusbekämpfungsprogramme. In: Ahlheim/Schillo, Politische Bildung zwischen Formierung und Aufklärung, 2012, S. 144-154.
- Benno Hafeneger, „Der Bildungsbereich wird zunehmend ein Handlungsfeld der AfD werden“. Interview. In: dis.kurs, Nr. 3, 2018, S. 4-6.
- Franziska Hein, AfD-Meldeportale – Juristen sehen keine dienstrechtlichen Folgen. In: MiGAZIN, 12.10.2018, online: http://www.migazin.de/2018/10/12/afd-meldeportale-juristen-sehen-keine-dienstrechtlichen-folgen/.
- Freerk Huisken, Die Wissenschaft von der Erziehung – Einführung in die Grundlügen der Pädagogik. Hamburg 1991.
- Hans-Joachim von Olberg, Der Bock wird Gärtner: Desiderius-Erasmus-Stiftung der AfD. In: Polis, Nr. 3, 2018, S. 4-5.
- Siegfried Schiele/Herbert Schneider (Hg.), Reicht der Beutelsbacher Konsens? Schwalbach/Ts. 1996.
- Johannes Schillo, Für einen schwarzrotgoldenen Schlussstrich – AfD und politische Bildung. In: Außerschulische Bildung, Nr. 2, 2017, S. 51-57, online: https://www.adb.de/download/publikationen/AB_2-2017_Beitrag_Jahresthema_Johannes_Schillo.pdf.
- Johannes Schillo, Alternative Parlamentsarbeit für Deutschland – Die AfD schreitet zur Tat. In: Auswege, Online-Magazin der GEW, 1.6.2018a, online: https://www.magazin-auswege.de/2018/06/alternative-parlamentsarbeit-fuer-deutschland/.
- Johannes Schillo, Die AfD und ihre Desiderius-Erasmus-Stiftung. In: Auswege, Online-Magazin der GEW, 4.10.2018b, online: https://www.magazin-auswege.de/2018/10/die-afd-und-ihre-desiderius-erasmus-stiftung/.
September
Migrationspolitik – die „Mutter aller Probleme“?
Droht Deutschland eine „feindliche Übernahme“ (Sarrazin) durch islamische Horden? Ist der von oben angeheizte nationale Flüchtlingsstreit „die Mutter aller Probleme“ (Seehofer)? Muss man realistischer Weise im Flüchtlingszustrom den Hauptgefährder des „gesellschaftlichen Zusammenhalts“ (so die Mehrheit) sehen? Dazu ein Kommentar von Suitbert Cechura.
Nach den Vorfällen in Chemnitz äußerte Bundesinnenminister Seehofer auf der CSU-Klausurtagung „Verständnis für die Demonstranten“ (d.h. für die „besorgten Bürger“ von rechts) und nannte „Migration wörtlich ‚die Mutter aller Probleme‘„ (https://www.tagesschau.de, 6.9.18). Auf empörte Reaktionen hin nahm der Innenminister die Aussage keineswegs zurück, präzisierte sie nur dahingehend, dass er nicht die Migration an sich, sondern die Migrationspolitik gemeint habe, wie sie in Deutschland für einen kurzen Sommer der „Willkommenskultur“ Einzug gehalten hatte. Thilo Sarrazins neues Opus „Feindliche Übernahme: Wie der Islam den Fortschritt behindert und die Gesellschaft bedroht“ schaffte es im September aus dem Stand auf die vorderen Plätze der Bestsellerlisten. Zentrales Thema ist bei ihm natürlich die „Kriminalitätsbelastung“, die durch die Anwesenheit der Flüchtlinge seit 2015 signifikant gestiegen sei, wie der Autor wieder anhand seines eigenwillig zusammengestellten statistischen Materials ausbreitet (vgl. sein Statement auf: https://www.tichyseinblick.de, 1.9.18). Dies sind nur zwei Beispiele für die neue Tonlage der Republik. Zu den damit verbundenen Bedrohungsvorstellungen im Folgenden ein Kommentar.
„Mit den Flüchtlingen steigt die Kriminalität“
Eins haben Pegida und AfD geschafft: Bei jedem Kriminalfall wird mittlerweile aufgeführt, ob einer oder mehrere der Beteiligten einen Migrationshintergrund haben. War es vor den Ereignissen der Kölner Silvesternacht 2015/16 Usus, dies bei Meldungen über kriminelle Akte zu unterlassen – weil es ja für die Tat oder das Opfer unerheblich ist, für die polizeilichen Ermittlungen meistens auch –, so wurden Medien und politische Öffentlichkeit in der Folge mit dem Verdacht belegt, sie würden den Bürgern etwas verschweigen. Der Vorwurf hat offenbar getroffen, seitdem hat sich die Berichterstattung gewandelt und das in doppelter Hinsicht: Zum einen wird vermerkt, wenn ein Beteiligter über eine nicht-deutsche Nationalität bzw. einen Migrationshintergrund verfügt, zum anderen sind Meldungen über Gewalttaten, die zum normalen Alltag gehören und damit oft nur eine Randnotiz bilden, stärker in den Fokus gerückt, wenn sich an ihnen das Ausländerthema festmachen lässt. Den rechten Politikern ist damit schon im Prinzip und für die öffentliche Wahrnehmung entscheidend der Beweis gelungen, dass Migranten die Gefahr erhöhen, Opfer von Gewalttaten zu werden.
Sicher: Armut, Kriegserfahrung und Flucht können zur Verrohung beitragen und unter den Flüchtlingen befinden sich neben traumatisierten, erschöpften und abgestumpften Menschen auch solche, die bereit sind, Gewalt auszuüben. Doch nicht die Tatbestände, die zur Verrohung – keineswegs bloß von Flüchtlingen – führen, sind Gegenstand rechter Kritik, schließlich finden sich auch im rechten Milieu und nicht nur dort gewalttätige Figuren. Vielmehr soll die Tatsache, dass es hierzulande überhaupt Menschen ausländischer Herkunft gibt, die Gefahr von Gewalttaten erhöhen, alles nach dem Motto: Wenn es die Öffnung der Grenzen nicht gegeben hätte, dann wäre dieser und jener Mensch in Kandel oder Chemnitz noch am Leben. Eine seltsame Logik, die eigentlich gegen den spricht, der den Vorwurf erhebt, denn immer noch werden die meisten Gewalttaten von Deutschen ausgeübt.
„Unser schönes Deutschland“, für das nicht allein Rechte mit Fahnen und schwarz-rot-goldenen Emblemen eintreten, ist voll von Gewalt. Bemerkbar schon ganz banal im Straßenverkehr, wo nicht nur bei illegalen Straßenrennen Menschenleben aufs Spiel gesetzt werden. Auch auf der Autobahn, wo Drängler und Raser eigenes und fremdes Leben riskieren, bis hin zu Streitereien um Parkplätze kommt es zu Gewalttaten. Nicht zuletzt die hochgelobte Familie mit ihrem Umfeld ist der gefährlichste Ort der Republik, die meisten sexuellen Vergehen an Kindern finden hier statt und die überfüllten Frauenhäuser dokumentieren die Gewalt in den Familien; nicht selten löschen Eltern in letzter Konsequenz einschlägiger „Familiendramen“ alle Angehörigen aus, weil sie ihr Leben in und mit der misslungen familiären Idylle nicht mehr ertragen. Und wie neuere Enthüllungen gezeigt haben, erweisen sich stinknormale Beschäftigungsverhältnisse, kirchliche Einrichtungen, Sportverbände etc. immer wieder als Brutstätten sexueller Gewalt.
Dies alles gilt als selbstverständlich und ist kein Anlass für eine besondere Erregung, führt in den meisten Fällen nicht zu einer groß aufgemachten Pressemeldung und noch seltener zu einem Trauermarsch durch die Gemeinde. Da muss es schon ein herausragendes Ereignis sein, wo sich etwa Sex und Crime sensationell verbinden – wie beim Horrorhaus in Höxter oder beim Anbieten des eigenen Kindes im Internet zum Missbrauch –, damit die Sache überhaupt in die überregionalen Schlagzeilen gelangt. Die mitfühlenden Bürger sehen sich eben nicht bei jedem Kindstod veranlasst, am Tatort Blumen niederzulegen oder Kerzen aufzustellen. Dafür braucht es schon ein Ereignis, das ihnen als besonderer Anlass zu entsprechender Aufmerksamkeit und Betroffenheit nahe gebracht wird.
Bei Gewalttaten unter Beteiligung von Ausländern ist dies inzwischen anders, nicht zuletzt wegen der größeren medialen Aufmerksamkeit, die regelmäßig hergestellt wird. In Windeseile finden sich zahlreiche Bürger und Bürgerinnen ein, die sich von der Tat erschüttert zeigen und ihre Trauer zum Ausdruck bringen wollen – d.h. Leute, die weder das Opfer noch den Täter gekannt haben, den Kontakt zu den getöteten oder verletzten Personen womöglich gemieden oder mit ihnen überhaupt keine Gemeinsamkeit entdeckt hätten. Und auch die Politik tritt neuerdings regelmäßig an, um ihre Erschütterung und Trauer zu demonstrieren – was der Gipfel der Heuchelei ist. Spätestens hier könnte jeder merken, dass es nicht um Trauer über den Verlust eines geliebten oder geschätzten Menschen geht, sondern dass persönliche Betroffenheit für politische Zwecke demonstriert wird, nämlich zur Betonung der Menschlichkeit, die die eigene Politik auszeichnen soll, so als wäre sie ganz von solchen Gefühlen bestimmt. Eine Heuchelei, die den Politikern natürlich nicht schwer fällt, schließlich schaffen sie es sogar, Trauer und Erschütterung beim Tod von Soldaten zu zeigen, die sie in den Krieg geschickt und damit ihrem Schicksal ausgeliefert haben.
„Das christliche Abendland geht unter“
Aber nicht nur mit Leib & Leben, Hab & Gut sollen sich die Eingeborenen am Standort D bedroht fühlen, sondern auch und vor allem – Stichwort: Islamisierung – in ihrer Kultur, speziell der christlichen. Dazu ist als Erstes zu sagen: Der Islam ist nicht mit den Flüchtlingen nach Deutschland gekommen, sondern mit den Migranten aus der Türkei, aus Jugoslawien oder den arabischen Ländern. Er hat lange Zeit ein Hinterhofdasein geführt, weil die Moscheen in alten Fabrikhallen oder Lagerhäusern angesiedelt waren und das religiöse Leben von der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen wurde. Zum Streitgegenstand wurde er, als Moscheen gebaut wurden, die als solche in der Öffentlichkeit erkennbar waren, als etwa der Ruf des Muezzins erschallte oder Minarette im Stadtbild sichtbar wurden. Eine andere Dimension erhielt die Islamdiskussion mit den Terroranschlägen frommer Fanatiker, mit dem Auftreten von Al Kaida oder IS. Seitdem steht der Islam immer auch für islamistischen Terrorismus und für Terrorgefahr. Mit der Öffnung der Grenzen für die Balkanflüchtlinge wurde die Flüchtlingsdebatte dann zu einer Sicherheitsdebatte. Die ausgesetzte Grenzkontrolle galt als Sicherheitsrisiko, weil auf diesem Wege auch Terroristen einreisen könnten. Letzteres zählte und zählt als schwerwiegendes Bedenken, obgleich auch scharfe Sicherheitskontrollen an Grenzen nicht in der Lage sind, den Einreisenden ihre terroristische Absicht anzusehen.
Betont wird in der Debatte um den Islam immer wieder, dass dieser rückständigen Religion der Geist der Aufklärung abgehe und dass sie nicht zur christlichen Tradition Deutschlands passe. Dabei wird die Tradition geradezu auf den Kopf gestellt, wandten sich doch die Aufklärer meistens gegen die Religion überhaupt und gegen deren Autorität im gesellschaftlichen Leben, hoben den Primat der Vernunft hervor und wollten – siehe Voltaires „Écrasez l’infâme“ (Näheres dazu im betreffenden Wikipedia-Eintrag) – keine Toleranz gegenüber dem Glauben walten lassen. Lessings „Nathan der Weise“ mit seinem treudoofen Toleranzappell steht eben nicht für alle Aufklärer!
Die heutige Stellung der Religion in der deutschen bzw. europäischen Gesellschaft ist daher auch nicht das Resultat einer geistigen Strömung, der Ausbreitung von „la lumière“ (wonach die Epoche im Französischen benannt ist), sondern einer gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen staatlichen und religiösen Autoritäten. Schließlich ging und geht es um sehr grundsätzliche Fragen, vor allem darum, wem die Bürger in letzter Instanz verpflichtet sind – dem Herrn im Jenseits und seinen irdischen Vertretern oder den staatlichen Gesetzen und den realen Machthabern? Dies ist selbst in modernen Gesellschaften nicht immer eindeutig geregelt, wenn z.B. kirchliche Trauungen staatlich anerkannt sind oder fromme Werke ein eigenes Arbeitsrecht erlassen dürfen. Im Prinzip gilt jedoch in der westlichen Welt der Primat des Staates und seiner Gesetze, denen sich auch die Religionsgemeinschaften zu fügen haben. Wie gesagt, als Resultat eines Kampfes, der sich im Namen der Aufklärung gegen das christliche Abendland richtete.
Die Rolle, die die Religion dadurch in Deutschland und den meisten anderen europäischen Ländern spielt (Ausnahmen, z.B. Polen, gibt es auch), sieht in vielen Ländern, aus denen Flüchtlinge stammen, anders aus. In diesen Ländern ist der Staat meist keine verbindliche Lebensgrundlage für alle Bürger, die sich in der Konkurrenz um Gelderwerb zu bewähren und ihr Leben damit selbst zu bestimmen haben, sondern eine Instanz, an der man durch persönliche Beziehungen entweder Teil hat oder nicht. Deswegen spielen verwandtschaftliche, ethnische und gerade auch religiöse Beziehungen eine wesentlich größere Rolle als in Deutschland und so entscheidet öfters der Religionsvorsteher über gesellschaftliche Angelegenheiten.
Apropos: christliche Tradition
Wenn von christlichen Politikern immer wieder das christliche Erbe Deutschlands betont wird, dann geschieht dies aber nicht, um an eine dunkle Vergangenheit zu erinnern, die durch das Licht der Aufklärung überwunden wurde. Im Gegenteil, es ist die Überhöhung der christlichen Vergangenheit, als Thron und Altar noch in trauter Eintracht verbunden waren. Viele Regelungen dieser Vergangenheit – an denen besonders traditionsbewusste Vereine wie die katholische Kirche verbissen festhalten – sind den Moralvorstellungen von Menschen aus islamisch geprägten Ländern nicht unähnlich. Schließlich galt auch in Deutschland bis in die 1950er Jahre, dass die Frau dem Manne untertan zu sein hatte, der Geschlechtsverkehr eine eheliche Pflicht bzw. Vergewaltigung der Ehefrau keine Straftat war oder die Gattin nur arbeiten durfte, wenn der Ehemann und Haushaltsvorstand es ihr erlaubte. Junge Frauen, deren voreheliche Beziehungen durch Schwangerschaft offenkundig wurden, galten in dieser gerade mal ein paar Jahrzehnte zurückliegenden Zeit als verwahrlost und wurden in Heimen für gefallene Mädchen untergebracht. Die moralische Erziehung in den Einrichtungen der Jugendhilfe durch die christlichen Kirchen und Verbände wird noch heute an runden Tischen aufgearbeitet – und immer wieder erfährt man (gerade bei den letzten Meldungen zu deutschen, niederländischen oder amerikanischen Vorkommnissen), dass die Kirchen sich mit Zähen und Klauen gegen eine Offenlegung aller ihrer Schandtaten wehren.
Die christliche Tradition war aber nicht nur von sexuellen Übergriffen, sondern von einem offiziell anerkannten Zugriff auf Kinder und Jugendliche, von rigiden Vorstellungen in puncto Recht und Ordnung, Autorität und Kadavergehorsam geprägt – Vorstellungen, die im Zweifelsfalle mit dem Rohrstock durchgesetzt wurden. Ein Geheimnis waren diese Praktiken nicht, entsprachen sie doch den damaligen Moralvorstellungen, die auch in vielen Familien zu entsprechenden Erziehungspraktiken führten. Aufgekündigt wurden diese Vorstellungen nicht durch eine aufgeklärte Diskussion, sondern durch eine Rebellion junger Menschen, die deshalb auch nicht selten den Polizeiknüppel im Auftrag von christlichen Politikern zu spüren bekamen. Geändert haben die Kirchen ihre Vorstellungen von Moral erst als ein Mitgliederschwund einsetzte und sie an öffentlichem Einfluss verloren. Sie benutzen aber nach wie vor ihre herausgehobene Stellung etwa als Arbeitgeber von sozialen Einrichtungen, um die dort Tätigen auf ihre Moralvorstellungen zu verpflichten. Manches Arbeitsverhältnis mündet daher in Gerichtsverhandlungen, wenn ein Mitarbeiter katholischer Einrichtungen nach einer gescheiterten Ehe wieder heiraten will. So verteidigt auch heute noch die Kirche ihre Moralvorstellungen mit Gewalt.
Ein letzter Punkt zum Aufregerthema Verschleierung: Dass Frauen eine wandelnde Versuchung für den Mann darstellen, weswegen sie sich zu verhüllen haben – auch diese Vorstellung ist im ach so aufgeklärten christlichen Abendland noch nicht verschwunden. Sie zeigt sich nicht nur in der Verhüllung der Nonnen, sondern auch noch in der allgemein beliebten Hochzeitszeremonie: Die Braut in Weiß steht für die Jungfräulichkeit, mit der sie die Ehe einzugehen hat. Verschleiert tritt sie vor den Altar, der Schleier wird erst gelüftet und die Braut darf erst geküsst werden, wenn die Ehe geschlossen ist. Ein Kult, dessen Inhalt den meisten Menschen nicht mehr bewusst ist, der aber bis in die 1960er Jahre praktische Konsequenzen hatte, wenn offenkundig war, dass die Braut nicht mehr jungfräulich vor den Altar trat – dann wurde ihr nämlich die Hochzeit in Weiß verweigert! Und ausgestorben ist dieser Hochzeitskult ja keineswegs, gilt vielmehr bei jungen Paaren oft als das Highlight ihrer Partnerschaft, das mit größtem Aufwand inszeniert und zelebriert wird, getreu dem Motto aus den 1960ern: „Ganz in Weiß mit einem Blumenstrauß, so siehst du in meinen schönsten Träumen aus…“
Ökonomische Grundlagen einer kommunistischen Gesellschaft
Zum Sommer 2018 ist die Veröffentlichung „Grundprinzipien kommunistischer Produktion und Verteilung“ erschienen, die an eine Debatte aus den 1930er Jahren erinnert. Das Thema hat auch zu aktuellen Kontroversen geführt. Dazu ein Beitrag von Hermann Lueer.
1930 erschienen als Kollektivarbeit der holländischen Gruppe Internationaler Kommunisten (GIK) die „Grundprinzipien kommunistischer Produktion und Verteilung“ (GIK 1970). Hermann Lueer hat die Ideen dieser Broschüre wieder aufgegriffen, die angesichts der sich abzeichnenden Erfahrungen mit dem Staatskommunismus in Russland entstanden war und die versuchte, die bereits von Marx und Engels skizzierte ökonomische Grundlage einer kommunistischen Gesellschaft wissenschaftlich auszuarbeiten. Die dabei angesprochenen Punkte kommen auch in aktuellen Debatten vor, die sich mit der Frage nach der Alternative zum Kapitalismus befassen.
In Köln veranstaltet z.B. die TtE-Bücherei (Bibliothek und Archiv linker sozialer Bewegungen) am 13. November 2018 im Bürgerzentrum Alte Feuerwache eine Veranstaltung „Verein freier Menschen? Idee und Realität kommunistischer Ökonomie“ (siehe: https://www.altefeuerwachekoeln.de/veranstaltung/info-diskussion/786?month=201811). Bei der Veranstaltung wird Hannes Giessler Furlan sein gleichnamiges Buch vorstellen (Furlan 2018). Zu dem Buch heißt es in der Verlagsankündigung: „Ihrer Idee nach sollte die kommunistische Gesellschaft viel gerechter als die kapitalistische sein und überdies nach Marx ein ‚Verein freier Menschen‘. Doch im Namen des Kommunismus verwirklicht hat sich im 20. Jahrhundert vor allem eine totalitäre Gesellschaft.“ Die Ursachen des Misslingens will Furlan dort suchen, „wo der Kommunismus ansetzte: in der Ökonomie. Mit Sympathie für die Beweggründe, aber ohne falschen Respekt zeigt der Autor, wie die kommunistische Idee eines vernünftig eingerichteten Produktionsprozesses in der Realität einen gewaltigen Staats- und Planungsapparat bedingte, wie sie scheiterte, und was von ihr übrig geblieben ist.“ (https://zuklampen.de/buecher/sachbuch/philosophie/bk/870-verein-freier-menschen.html).
In Köln will der Autor die Vorstellung seines Buches auf die Kritik des Rätekommunismus zuspitzen, also auch auf Positionen, wie sie die GIK vertreten hat. Solche Positionen stehen heute – wie die TtE-Ankündigung schreibt – zumindest in kleinen Zirkeln, „in denen das humanistische Versprechen des Kommunismus gehütet und über die Zeit gebracht wird, hoch im Kurs“. Explizit erwähnt wird dabei das „lesenswerte“ Pamphlet „Umrisse der Weltcommune“, das von den Freundinnen und Freunden der klassenlosen Gesellschaft im Frühjahr vorgelegt wurde (Weltcommune 2018). „Wenngleich der Rätekommunismus historisch fast keine Schuld auf sich geladen hat“, heißt es dazu, liefere auch er kaum Antworten auf die entscheidenden Fragen. Diese lauteten: „Wie kann die kommunistische Produktion zugleich demokratisch und planmäßig organisiert sein? Wie kann die kommunistische Gesellschaft das Problem der Arbeitszeitrechnung lösen? Oder soll sie auf Arbeitszeitrechnung verzichten – aber wie soll dann das zentrale Anliegen kräfteschonender Produktion und Bedürfnisbefriedigung realisiert werden? Und wie kann gewährt werden, dass die Überwindung des Leistungsprinzips und der Tauschgerechtigkeit nicht in Ungerechtigkeit mündet?“
Hermann Lueer hat zu dem Pamphlet „Umrisse der Weltcommune“ (das online greifbar ist, siehe unten) ebenfalls Stellung genommen. Eine Replik des Autorenteams steht noch aus. IVA veröffentlicht im Folgenden das Statement von Lueer in einer leicht überarbeiteten Fassung.
Gut umrissen! Aber…
Den Umrissen als ersten „Konturen eines freien Gemeinwesens“ kann ich weitgehend zustimmen, vor allem in folgenden Prinzipien und Perspektiven, die ihr benennt:
- eine an den Bedürfnissen der Menschen ausgerichtete Transformation der existierenden Maschinerie (Weltcommune 2018, 6ff),
- die weitgehende Auflösung der Trennung von Hand- und Kopfarbeit über eine andere Priorität der Ausbildung sowie die Abschaffung sinnloser, ermüdender Tätigkeit im Rahmen von Automatisierung, ferner die ansprechende Gestaltung bzw. Rotation weiterhin notwendiger Tätigkeiten (ebd., 15),
- das Verfügbarmachen riesiger Zeitpotentiale dank der Abschaffung von Tätigkeiten, die allein für den Kapitalismus nützlich sind (ebd., 12f),
- die Emanzipation der Menschen aus den heutigen Geschlechterverhältnissen, indem ihre Abhängigkeit von der Lohnarbeit aufgehoben wird (ebd., 20ff),
- und damit nicht zuletzt die Perspektive, dass der gesellschaftliche Reichtum der Zukunfts-Commune auf Grund der Durchsetzung dieser Prinzipien kaum so aussehen wird, wie man ihn als privaten Reichtum im Kapitalismus kennt (ebd., 13).
Ähnliche Perspektiven hat übrigens auch schon Norbert Trenkle aufgezeigt (Trenkle 1996).
Ihr schreibt: „Stellt man sich die Revolution … nicht als das blaue Wunder vor, als etwas, das die Proletarier im Eifer des Gefechts beinahe aus Versehen machen, spontan und ohne jedes vorab gefasste Ziel, und delegiert man die menschliche Emanzipation erst recht nicht an die Maschinen, dann“ – da stimme ich euch ebenfalls zu – ist eine Verständigung über die Grundzüge der klassenlosen Gesellschaft nicht nur sinnvoll, sondern erforderlich, da kaum eine „Bewegung entschlossen gegen das Bestehende aufbegehrt, ohne wenigstens eine vage Ahnung davon zu haben, was an seine Stelle treten könnte.“ (Weltcommune 2018, 2)
Dass hierzu das Aufzeigen der Perspektiven und Potentiale hilfreich sein kann, ist sicherlich richtig aber, wie ihr selbst schreibt, nicht ausreichend: „Über die gesellschaftlichen Formen, in denen das machbar wäre, ist damit noch wenig gesagt. Daran hängt aber alles: … Es geht um eine andere gesellschaftliche Vermittlung, eine, in der sich das Ganze nicht gegen die Einzelnen wendet, sondern deren bewusstes Werk ist.“ (Ebd., 16) Die entscheidende Frage, die – neben der Kritik des Kapitalismus als Grundlage für ein Aufbegehren – einfach und für jeden verständlich beantwortet werden muss, lautet daher: Wie können die Gesellschaftsmitglieder auf der Grundlage vergesellschafteter Produktionsmittel ihren arbeitsteiligen Zusammenhang ohne eine ihnen übergeordnete Instanz selbständig nach dem Motto „Jedem nach seinen Bedürfnissen, jeder nach seinen Fähigkeiten“ (Marx) leiten und verwalten?
Streitpunkt: abstrakte Arbeit
Bei der Beantwortung dieser entscheidenden Frage macht ihr, meiner Ansicht nach, einen schweren Fehler: Ihr verwerft die ökonomische Grundlage, auf der die gesellschaftlichen Beziehungen der Menschen zu ihren Arbeiten und ihren Arbeitsprodukten einfach und für alle durchsichtig in Produktion und Verteilung geregelt werden können, weil ihr die Arbeitszeitrechnung mit einem Tauschverhältnis verwechselt. Dem von Marx und Engels grob entworfenen Modell der Arbeitszeitrechnung haltet ihr zwar zunächst etwas zugute: „Als bloße Fortsetzung der Lohnarbeit mit anderen Mitteln lässt sich das Modell nicht abtun: Das Privateigentum an Produktionsmitteln soll gesellschaftlicher Planung weichen, die Arbeitskraft keine Ware mehr sein, deren Verkauf zufällig und unter Bedingungen der Konkurrenz stattfindet.“ (Ebd., 3) Einen Absatz später behauptet ihr dann aber ohne weitere Erläuterung, dass eine rationelle Form der Arbeitszeitrechnung, die bei der abstrakten Arbeit ihren Ausgangspunkt nimmt, in eine Sackgasse führe: „Der Äquivalententausch, im Kapitalismus letztlich eine Farce, wird sozialistisch wahrgemacht… Prinzipiell ließe sich einwenden, dass dort, wo Äquivalententausch herrscht, von Kommunismus keine Rede sein kann.“ (Ebd., 4)
Wie passt das zusammen? Tausch setzt Eigentum an Produktionsmitteln und den damit produzierten Gütern voraus. Auf der Grundlage vergesellschafteter Produktionsmittel (im Unterschied zur Verstaatlichung) gibt es daran aber kein Eigentum mehr, und weder die Produkte noch die Arbeitskraft sind Waren, die im Tausch zwischen Eigentümern vermittelt werden. Die individuelle Arbeit der Gesellschaftsmitglieder ist hier nicht mehr Privatarbeit, die erst über den Tausch ihre gesellschaftliche Vermittlung sucht, sondern bereits unmittelbar Bestandteil der gesellschaftlichen Gesamtarbeit, da sie als individuelle Arbeit bereits im Rahmen der gemeinschaftlichen Planung geleistet wird. Dementsprechend ist das individuelle Arbeitsprodukt auch kein Privateigentum mehr, sondern Produkt der Gesellschaft, das nicht als Ware zwischen verschiedenen Eigentümern verkauft (=getauscht) wird, sondern innerhalb der Gemeinschaft der Produzenten für den Konsum zur Verfügung steht.
An dieser Bestimmung ändert sich auch über den Bezug auf die abstrakte Arbeit sowie die Zeit als ihr Maß im gesellschaftlichen Planungsprozess nichts. Die Reproduktion der Gesellschaft setzt schlicht voraus, dass die zur Befriedigung der Bedürfnisse notwendige Arbeit in gesellschaftlicher Arbeitsteilung planmäßig organisiert und umgesetzt wird. Planung des gesellschaftlichen Reproduktionszusammenhanges bedeutet aber nichts anderes, als die zur Bedürfnisbefriedigung erforderliche gesellschaftliche Arbeitszeit mit der Summe der zur Verfügung stehenden individuellen Arbeit zu verbinden. Das kann einer zentralen Planungsbehörde übertragen werden – soweit man dieser vertrauen will – oder den Individuen selbst überlassen werden. Letzteres ist aber nur möglich, wenn das Verhältnis von Arbeitsaufwand zu Ertrag für alle Gesellschaftsmitglieder systematisch aufgezeigt wird. Dann ist eine arbeitsteilige Produktionsplanung möglich, bei der die Menschen selbst entscheiden, was sie gemäß ihrer individuellen Abwägung von Aufwand und Ertrag haben möchten. Das heißt, es kann jeder selbst über seinen Beitrag zur gesellschaftlich erforderlichen Arbeitszeit und seinen Anteil am Produkt der gesellschaftlichen Arbeitsteilung bestimmen.
„Die Arbeitszeit,“ wie Marx es ausdrückt, „würde also eine doppelte Rolle spielen. Ihre gesellschaftlich planmäßige Verteilung regelt die richtige Proportion der verschiedenen Arbeitsfunktionen zu den verschiedenen Bedürfnissen. Andererseits dient die Arbeitszeit zugleich als Maß des individuellen Anteils des Produzenten an der Gemeinarbeit und daher auch an dem individuellen verzehrbaren Teil des Gemeinproduktes.“ (MEW 23, 93) In welcher Form hierbei die individuelle Arbeitszeit als das Maß für den individuell zu konsumierenden Teil des gesellschaftlichen Produkts zur Anwendung kommt, wäre dann einer konkreten Regelung der Gesellschaft zu überlassen – je nach Einsicht der Gesellschaftsmitglieder in die Notwendigkeiten ihres kooperativen Produktionszusammenhanges. Sie können es beispielsweise bei der Bereitstellung der Information über die Arbeitszeiten belassen und auf den vernünftigen Umgang mit solchen Planungsgrößen setzen. Sie können eine individuelle „Unterdeckung“ der Arbeitsbeteiligung im Verhältnis zum Konsum auch zum Anlass für Kritik nehmen oder den Zugang zu Konsumtionsmitteln in Relation zum individuellen Beitrag zur gesellschaftlichen Arbeit beschränken.
Ob es nun aus individueller Einsicht in die Notwendigkeiten des arbeitsteiligen gesellschaftlichen Zusammenhanges geschieht oder über die Not gesellschaftlicher Rationierung, ist im Prinzip egal: Über die planmäßige Koppelung zwischen dem individuellen Beitrag zur gesellschaftlich erforderlichen Arbeitszeit und dem diesem entsprechenden Anteil am Gemeinschaftsprodukt herrscht hier zwar dank dem Maßstab der abstrakten Arbeit dasselbe Prinzip, „das den Warenaustausch regelt, soweit er Austausch Gleichwertiger ist. Inhalt und Form sind verändert, weil unter den veränderten Umständen niemand etwas geben kann außer seiner Arbeit und weil andererseits nichts in das Eigentum der einzelnen übergehen kann außer individuellen Konsumtionsmitteln.“ (MEW 19, 20) Dies ist ein gewaltiger Unterschied zum Begriff des „Äquivalententauschs“! Die gemeinschaftliche Planung des Zusammenhangs von gesellschaftlichem Produkt und gesellschaftlich notwendiger Arbeit oder, anders ausgedrückt, die gesellschaftliche Vermittlung zwischen Bedürfnis und der zur Bedürfnisbefriedigung erforderlichen gesellschaftlichen Arbeit hat mit einem Äquivalententausch individueller Privateigentümer jedenfalls nichts zu tun. „Ein solcher Kommunismus wäre“ daher auch entgegen eurer Aussage etwas ganz anderes „als eine schlechte Imitation des kapitalistischen Marktes, auf dem sich das Gesetz der Arbeitszeit blind und regellos durchsetzt.“ (Weltcommune 2018, 5) Hier wären die Gesellschaftsmitglieder weder dem Wertgesetz blind unterworfen noch seiner realsozialistischen bewussten und „gerechten“ Anwendung. Hier würden die Gesellschaftsmitglieder auf der Grundlage vergesellschafteter Produktionsmittel ihren arbeitsteiligen Zusammenhang mit Hilfe der Arbeitszeitrechnung ohne eine ihnen übergeordnete Instanz selbständig planen und verwalten. „Die Nutzeffekte der verschiedenen Gebrauchsgegenstände, abgewogen untereinander und gegenüber den zu ihrer Herstellung nötigen Arbeitsmengen, werden den Plan bestimmen. Die Leute machen alles sehr einfach ab, ohne Dazwischenkunft des vielberühmten ‚Werts‘.“ (MEW 20, 288)
Es ist ein Missverständnis, abstrakte Arbeit und die Zeit als ihr Maß mit Wertproduktion gleichzusetzen. In einem Produktionsverhältnis, das durch Privateigentum und Warentausch bestimmt ist, ist die abstrakte Arbeit zwar die Substanz des Werts, sie begründet aber nicht das Produktionsverhältnis. Ähnlich wie bei den Maschinenstürmern, die angesichts der Folgen der kapitalistischen Anwendung der Maschinen diese zerstören wollten, ist es daher ein Fehler, die Abstraktion von konkreten Arbeitsschritten und ihre zeitliche Zusammenfassung als Mittel der Produktionsplanung zu verwerfen.
Ist eine Ökonomie der Zeit machbar?
Aber diese Verwechselung der Arbeitszeitrechnung mit einem Tauschverhältnis ist zumindest in eurem Artikel nicht das Hauptargument gegen die Nutzung der Arbeitszeitrechnung. Mit dem Verweis auf den Beitrag von Raoul Victor „The Economy in the Transition to a Communist Society“ (Victor 2016) behauptet ihr im Folgenden vielmehr, die Arbeitszeitrechnung erweise sich „auf dem Niveau einer arbeitsteilig-hochtechnisierten gesellschaftlichen Produktion als Ding der Unmöglichkeit.“ (Weltcommune 2018, 4)
Wäre das so, dann müsste die Ökonomie im Kapitalismus wie auch im Kommunismus im Chaos versinken. Ohne den Tauschwert – der sich im Kapitalismus auf Grundlage des Privateigentums in der Konkurrenz auf dem Markt hinter dem Rücken der Menschen als Ermittlung der gesellschaftlich notwendigen Arbeitszeit herausbildet – und ohne die Arbeitszeit als direktes und bewusstes Maß einer gemeinschaftlichen Produktionsplanung ließe sich weder im Kapitalismus noch im Kommunismus rationell aufwandsbezogen entscheiden, welche der Vielzahl möglicher Substitute und Produktionsverfahren vorteilhaft wären. Der Kapitalismus beweist mit seiner tauschwertbezogenen Arbeitszeitrechnung auf seine Weise täglich das Gegenteil der behaupteten Unmöglichkeit. Wäre mit der Abschaffung der Geldrechnung die Arbeitszeitrechnung auf dem Niveau einer arbeitsteilig-hochtechnisierten sozialistischen Produktion ein Ding der Unmöglichkeit, dann hätte der Ökonom Ludwig von Mises recht: Der Sozialismus wäre dann die Aufhebung der Rationalität der Wirtschaft.
Die Vorstellung, die Planung einer arbeitsteilig-hochtechnisierten gesellschaftlichen Produktion ließe sich allein über die Bedürfnisse und die physische Beschaffenheit der Gebrauchsgegenstände realisieren, halte ich für einen Fehlschluss. Raoul Victor abstrahiert schlicht von der in der gesamten Produkt- und Produktionskette enthaltenen menschlichen Arbeit, wenn er behauptet: “The measure of human needs, on the one hand, and of the actual possibilities of production, on the other, in physical terms (e.g., the quantity of gallons of milk per child, on the one hand, and the number of dairy cows on the other), are far more simple to make than any assessments based on average social labor time.” (Victor 2016) Wer versorgt denn die Kühe, welches Melkverfahren ist weniger aufwendig, wie soll über verschiedene Transport- oder Verpackungsverfahren entschieden werden?
Wenn ihr schreibt: „Natürlich bedarf die planvolle Produktion in der Commune grober Vorstellungen darüber, wie viel Arbeitsaufwand etwas erfordert“ (Weltcommune 2018, 4), ist euch offensichtlich bewusst, dass weder die Milchproduktion noch irgendeine andere Produktion sich allein über den von Victor vorgestellten simplen Dreisatz rational planen lässt. Zwei Zeilen weiter schreibt ihr dann aber: „Die Koppelung von individueller Konsumtion an geleistete Arbeitsstunden unterstellt aber darüber hinaus die Möglichkeit, exakt zu beziffern, wieviel Arbeitszeit in jedem einzelnen Produkt steckt.“ (Ebd.) Wie kommt ihr hier auf den Übergang von grob zu exakt? Produktion und Konsumtion sind doch zwei Seiten einer Medaille? Warum soll auf der Konsumseite der grobe Maßstab nicht ebenso völlig ausreichend sein? Damit wäre aber die von euch behauptete Unmöglichkeit widerlegt.
In eurer weiteren Argumentation lasst ihr dann im Widerspruch zu eurer Aussage bezogen auf „die planvolle Produktion in der Commune“ selbst die falsche Unterscheidung – grob: möglich, exakt: unmöglich – fallen und behauptet plötzlich: „Je mehr zudem allgemeine Voraussetzungen wie etwa Transportmittel in ein Produkt einfließen, umso schwieriger wird das Unterfangen. Spätestens mit Einbezug der zunehmenden Verwissenschaftlichung der Produktion scheint es schlicht aussichtslos zu werden.“ (Ebd., 4f) Der Einwand, die Arbeitszeiten ließen sich nicht oder wenn dann nur mit einem irrwitzigem Aufwand den Millionen von Produkten und Dienstleistungen zurechnen, wird durch die kapitalistische Kostenträgerrechnung widerlegt. Die Ermittlung der produktbezogenen Herstellungskosten als Summe direkter und indirekter Material- und Fertigungskosten ist hier bei Verfahren der Gemeinkostenzurechnung sowie der Erfassung und Verrechnung von anteiligen Abschreibungen als tägliche Praxis anzutreffen. Warum sollten sich ähnliche Verfahren nicht genauso auf die Arbeitszeitrechnung anwenden lassen?
Probleme des Übergangs
Für den Fall, dass die Anwendung der Arbeitszeitrechnung doch kein Ding der Unmöglichkeit ist, habt ihr noch weitere Argumente, warum sie für eine kommunistische Gesellschaft nicht taugt: „Auch wenn ‚Arbeitszeitkonten‘ nicht dasselbe sind wie das Lohnsystem, stünde im Hintergrund weiter der Zwang.“ (Ebd., 5) Dagegen ließe sich einwenden: Den Gegensatz zwischen Bedürfnis und notwendiger Arbeit erzeugen nicht die Arbeitszertifikate, sondern die Natur selbst. Das Reich der Freiheit beginnt erst da, wo die Notwendigkeit der Arbeit aufhört. Durch die systematische Offenlegung des Zusammenhanges zwischen Bedürfnis und notwendiger Arbeit erzeugt die Gesellschaft keinen Gegensatz. Im Gegenteil: Den Gesellschaftsmitgliedern den Zusammenhang von Aufwand zu Ertrag anhand der Arbeitszeitrechnung offenzulegen ebenso wie ihren persönlichen Anteil an Arbeit und Konsum – darauf wird eine Gesellschaft nicht verzichten können, wenn ihre Gesellschaftsmitglieder selbst nach ihren Bedürfnissen über Arbeit und Konsum bestimmen wollen. Der „Verein freier Menschen“ (so Marx im ersten Band des „Kapital“) würde seinem Namen nicht gerecht, ignorierte er die materielle Grundlage, die ihn in die Lage versetzt, Produktion und Distribution selbst leiten und verwalten zu können. Verteilung ohne ökonomisches Maß bedeutet nicht „Nehmen nach Bedarf“, sondern Zuteilung durch eine übergeordnete Instanz.
Ihr schreibt: „Der von der bürgerlichen Gesellschaft geerbte Sozialcharakter, der dabei unterstellt wird, müsste zudem zu allerhand Schummeleien bei der Arbeitszeitrechnung neigen, was die Notwendigkeit sozialer Kontrolle zur Folge hätte.“ (Ebd.) Nun ja. Das mag schon sein, die Arbeitszeitrechnung ist je nach Handhabung eine Form der Kontrolle: stufenweise von der Selbstkontrolle bis zur gesellschaftlichen Kontrolle. Aber wäre es angesichts des „geerbten Sozialcharakters“ realistisch einen aufwandsbezuglosen Zugang zu den produzierten Gütern zu gewähren? Ich denke es kommt schon auf den Inhalt der Kontrolle an. Es wäre, wie Friedrich Engels einmal schrieb, an dieser Stelle „absurd, vom Prinzip der Autorität als einem absolut schlechten und vom Prinzip der Autonomie als einem absolut guten Prinzip zu reden.“ (MEW 18, 307) Weiter heißt es bei euch: „Das Modell setzt außerdem eine scharfe Trennung zwischen Arbeit und Nichtarbeit voraus, die nicht nur wenig attraktiv erscheint, sondern wiederum eine administrative Regelung dessen erfordern würde, was sich heute blind durchsetzt.“ (Weltcommune 2018, 5) Ja, auf eine Trennung zwischen „privater Arbeit“ – ich trage meinen Müll runter, ich koche für meine Freunde, organisiere mit der Nachbarschaft ein Straßenfest etc. – und gesellschaftlicher Arbeitsteilung – bei der Millionen von Menschen, die sich nicht persönlich kennen, einen arbeitsteiligen Produktionszusammenhang bilden – wird sich die Gesellschaft schon einigen müssen. Dazu muss die Arbeit, die den verschiedenen Zweigen der Produktion zugeführt werden soll, zuvor als „gesellschaftliche Arbeit“ registriert werden. Auf administrative Regelungen wird man auch in einer kommunistischen Gesellschaft kaum verzichten können, um die gesellschaftliche Produktion planmäßig organisieren zu können.
Die Ausgangsfrage, die in Hinblick auf die „Weltcommune“ überzeugend beantwortet werden muss, lautet, wie oben bereits ausgeführt: Wie können die Gesellschaftsmitglieder auf der Grundlage vergesellschafteter Produktionsmittel ihren arbeitsteiligen Zusammenhang ohne eine ihnen übergeordnete Instanz selbständig nach dem Motto „Jedem nach seinen Bedürfnissen, jeder nach seinen Fähigkeiten“ leiten und verwalten? Indem ihr in eurer Antwort die Arbeitszeitrechnung als ökonomische Grundlage der selbständigen Leitung von Produktionsprozessen verwerft, entzieht ihr eurer „Weltcommune“ den materiellen Boden und verweist sie stattdessen auf eine idealistische Utopie.
„Die notwendige Bewusstseinsveränderung hin zum ‚Verein freier Menschen‘ und zum ‚gesellschaftlichen Individuum‘“ (Weltcommune 2018, 11) soll sich nicht auf der Grundlage eines funktionierenden kommunistischen Produktionsverhältnisses herausbilden, sondern umgekehrt dieses erst ermöglichen. „Von dieser Bewusstseinsveränderung allerdings dürfte der Erfolg der kommunistischen Revolution letztlich abhängen“, heißt es bei euch weiter (ebd.). Dass auf dieser „Grundlage“ auch die Räteorganisation baden geht, wisst ihr selbst: „Dass alle über alles entscheiden, scheint im schlechten Sinne utopisch. Mit solchen Grenzen müsste bewusst umgegangen werden, um zu verhindern, dass sich erneut eine von Spezialisten bevölkerte politische Sphäre verselbständigt.“ (Ebd, 19) Aber wie soll mit dieser Situation „bewusst umgegangen werden“? Wenn die Räte selbst keine klaren Vorstellungen haben, wie, d.h. auf welcher ökonomischen Grundlage sich die Gesellschaft organisieren lässt, dann wird die ganze Sache zum unkalkulierbaren Abenteuer.
„Vorstellbar ist der Übergang in die Commune daher nur als wilde Bewegung der Besetzungen… Entscheidend wäre, das Eroberte sofort zur Ausweitung der Bewegung zu nutzen, ohne die alles wieder in sich zusammenfallen würde. Güter müssten einfach verteilt werden…“ (Ebd, 23) Aber so einfach ist das natürlich nicht, wie ihr selbst wisst: „Die kaum zu überschätzende Herausforderung besteht jedoch darin, über Beschlagnahmung und Verteilung von Gütern hinaus die Produktion auf neuer Grundlage wieder in Gang zu setzen.“ (Ebd, 24) „Zwischen dem Ist-Zustand und der möglichen Commune tut sich ein riesiger Abgrund auf und der hier skizzierte Sprung über diesen Abgrund hat unbestreitbar gewisse abenteuerliche Züge.“ (Ebd.) „Das Falsche der beiden Extrempositionen zu zeigen fällt nicht schwer … die Ausarbeitung eines Gegenentwurfs, der nicht spinnert-weltfremd erscheint, umso schwerer.“ (Ebd., 25)
Um diese von euch selbst befürchtete Weltfremdheit zu vermeiden, scheint mir – und da stimmen wir wieder überein – „eine Verständigung über die Grundzüge der klassenlosen Gesellschaft allemal sinnvoll.“ (Ebd., 1) Einverstanden: „Je mehr sich die Lohnabhängigen darüber international verständigen, je klarer sich das ganz Andere vor ihren Augen abzeichnet, desto besser die Chancen, dass doch noch eine umwälzende Bewegung zustande kommt.“ (Ebd., 25)
Nachweise
- Weltcommune – Freundinnen und Freunde der klassenlosen Gesellschaft, Umrisse der Weltcommune. 21. März 2018, online: https://kosmoprolet.org/de/umrisse-der-weltcommune?print=1.
- Hannes Giessler Furlan, Verein freier Menschen? Idee und Realität kommunistischer Ökonomie. Springe 2018.
- GIK – Gruppe Internationaler Kommunisten (Holland), Grundprinzipien kommunistischer Produktion und Verteilung (1930). Nachdruck: Berlin 1970.
- Hermann Lueer, Grundprinzipien kommunistischer Produktion und Verteilung. Hamburg 2018. (Siehe die Homepage: http://whyhunger.com/content/und-die-alternative_/ sowie unter der Rubrik Bücher: https://www.i-v-a.net/doku.php?id=books#hermann_lueer_grundprinzipien_kommunistischer_produktion_und_verteilung.
- MEW – Marx-Engels-Werke, zitiert nach der MEW-Ausgabe, Berlin, unter Angabe des Bandes und der Seitenzahl.
- Norbert Trenkle, Weltgesellschaft ohne Geld – Überlegungen zu einer Perspektive jenseits der Warenform. 31. Dezmeber 1996, online: http://www.krisis.org/1996/weltgesellschaft-ohne-geld/.
- Raoul Victor, The Economy in the Transition to a Communist Society. In: Internationalist Perspective, Nr. 61, 2016.
Macht unsere Gesellschaft die Seele krank?
„Unsere Gesellschaft macht krank“ ist der Titel eines Buches von Suitbert Cechura, das im September 2018 erschienen ist und dessen Thesen IVA zur Diskussion stellen will. Dazu eine Mitteilung der IVA-Redaktion.
Zum Thema „Gesundheit und Krankheit im Kapitalismus“ hat IVA bereits im Jahr 2016 Diskussionsangebote im Kölner Bürgerzentrum Alte Feuerwache gemacht. Es ist geplant, dies in der nächsten Zeit fortzusetzen, und zwar anhand der Thesen, die Suitbert Cechura jetzt mit seinem Buch „Unsere Gesellschaft macht krank – Die Leiden der Zivilisation und das Geschäft mit der Gesundheit“ vorgelegt hat (siehe Cechura 2018). Diskussionsbeiträge zu diesem Thema sind willkommen. Im Folgenden einige Hinweise zu möglichen Schwerpunkten einer solchen Debatte.
Macht Lohnarbeit verrückt?
In Diskussionen über das moderne Gesundheitswesen und speziell über die Rolle, die Psychotherapie und Psychiatrie darin spielen, gab es den Vorwurf der Ignoranz an die Adresse einer Kritik, die sich auf die kapitalistische Produktionsweise richtet. Sie greife nur das zugrundeliegende Produktionsverhältnis an, könne aber mit den seelischen Leiden der Zeitgenossen, ja mit dem „subjektiven Faktor“ überhaupt, wenig bis nichts anfangen (vgl. IVA 2016, Schillo 2016). Psychologie sei gewissermaßen der blinde Fleck der Kapitalismuskritik. Dem Buch von Albert Krölls zur „Kritik der Psychologie“ (Krölls 2016) wurde z.B. vorgehalten, es zeichne sich durch eine Missachtung der modernen psychotherapeutischen Bemühungen und Angebote aus, ja durch eine Verachtung der dort auflaufenden Patienten. Michael Zander machte seine grundlegenden Einwände schon an den terminologischen Fragen fest: Kategorien wie „verrückt“ oder „geisteskrank“, die bei Krölls vorkommen, hätten „in der Fachdebatte nichts zu suchen“ (Zander 2016).
Solche Vorbehalte zählen im heutigen Wissenschaftsbetrieb. Respektvolle Benennungen oder die Anerkennung etablierter Berufsstände und ihrer ehrenwerten Motive („Hilfe“, „Heilung“) sind gefordert, die Klärung der Sache hat sich daran zu relativieren. Alles natürlich im Interesse der Patienten bzw. Klienten! Und auf Systemkritik, heißt es, könnten von Angststörungen, Depressionen oder Burn-out gebeutelte Menschen gerne verzichten, auf therapeutische Hilfe nicht. Überhaupt gehe eine Sozialkritik, die auf die theoretische Einsicht in krankmachende Verhältnisse hinarbeite, an der Tatsache vorbei, dass sie es mit kranken Menschen zu tun habe, denen eine ‚verkopfte‘, rationale Argumentation keine Hilfe biete.
Schmerzlindernd ist das Buch von Cechura in der Tat nicht. Aber wer sich für die Sache interessiert, dem kann es Aufklärung bieten. Es hält sich nicht an die wissenschaftlichen Anstandsregeln, sondern nimmt den Gesundheitsbetrieb – bekanntlich ein wichtiger Wachstumsmarkt der deutschen Marktwirtschaft – rücksichtslos aufs Korn. Es entwickelt die Hauptthese „Unsere Gesellschaft macht krank“ in seinem ersten Teil, der von den modernen „Zivilisationskrankheiten“, von Epidemien, Lungen-, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs, Störungen des Stütz- und Bewegungsapparates, Allergien/Asthma und in einem ausführlichen Kapitel von den psychischen Erkrankungen handelt. (Der zweite Teil ist dann dem staatlich regulierten Geschäft mit der Gesundheit gewidmet: von der Arztpraxis und dem Kassenwesen über Apotheken, Pharmamarkt, das Krankenhaus, den Sonderfall Psychiatrie bis zu Reha-Maßnahmen und Pflege.)
Gegen die geforderte sprachliche Korrektheit hält Cechura erst einmal fest, dass es sich eher umgekehrt verhält, dass nämlich gerade der etablierte Betrieb den Tatbestand „Geisteskrankheit“ kennt und seine Anteilnahme am Leiden der Patienten dadurch zeigt, dass er es auf eine Stufe mit physischen Funktionsstörungen stellt, also gar nicht als geistige Leistung ernst nimmt. Was der Patient an Vorstellungen, Urteilen, Gefühlen äußert, soll ja nach gängiger Auffassung als Ausdruck einer zugrundeliegenden Krankheit gewertet werden, deren Charakter und Genese sich allein dem professionellen Blick der Zunft erschließt. Die Gleichsetzung mit physischer Krankheit hat natürlich für den krank-, d.h. arbeitsunfähig geschriebenen Patienten eine vital entlastende Funktion, was bei Cechura vorkommt und was dort ausführlich an den verschiedenen Abteilungen des Sozialgesetzbuches (SGB) oder der gesundheitspolitischen Klassifizierungssysteme (ICD, Anerkennung von Berufskrankheiten etc.) diskutiert wird. (Dies ist vor allem Thema im zweiten Teil des Buchs.)
Das vierte Kapitel des ersten Teils (Cechura 2018, 142ff) befasst sich mit den psychischen Erkrankungen, die laut „Bericht Gesundheit in Deutschland 2015“ für die meisten Krankheitstage verantwortlich sind und die bei den Krankheitskosten an dritter Stelle rangieren. Der erste, grundsätzliche Kritikpunkt Cechuras zielt, wie gesagt, auf die Einordnung ins Schema physiologischer Krankheiten. Dabei sei gerade erkennbar, wie Cechura ausführt, dass hier ein ganz anderer Fall vorliegt als ein geschädigtes, infiziertes oder verletztes Organ. Beim „neurotischen“ Verhalten (oder wie die Klassifizierung nicht-normaler, dysfunktionaler Aufführung sonst lauten mag) handle es sich um das selbstbewusste, gegen die praktisch gültigen Zwecke eines modernen Kapitalstandorts durchgehaltene, letztlich verzweifelte Bemühen, in der kapitalistischen Konkurrenzgesellschaft den individuellen Erfolg zu suchen – um ein Bemühen, das der Logik des freien Wettbewerbs folgend („Jeder ist seines Glückes Schmied“) unter bestimmten Bedingungen zum (selbst-)destruktiven Rückschlag auf die eigene Funktionstüchtigkeit führe, physiologische Folgeschäden inbegriffen.
Die seelischen Leiden haben also laut Cechura einen ganz anderen Status als die physiologischen Erkrankungen, die sich – so die Beweisführung im ersten Teil der Publikation – auf den Verschleiß der Arbeitskraft für eine Profitzweck und die Herrichtung von Stadt, Land, Fluss für dessen Wachstumsbedürfnisse zurückführen lassen. So weiß ja auch der moderne Medizinbetrieb mit seinen umfangreichen Statistiken, dass körperliche Gesundheit im strikten Sinne eine soziale Frage ist: „Zivilisationskrankheiten“ treffen vor allem arme Menschen, die arbeitende oder in Arbeitslosigkeit entlassene Bevölkerung; hier ist die Lebenserwartung geringer und hier werden von Fall zu Fall – meistens nach Jahrzehnte-langem Leiden – „Berufskrankheiten“ anerkannt (Cechura 2018, 19). Bei psychischen Leiden sieht die soziale Verteilung der Leiden bekanntlich etwas anders aus. An Depressionen leiden auch Milliardärsgattinnen und ein Burn-out kann genau so bei einem Starpianisten auftreten. Ist also hier die Krankheitsursache doch eine Frage des individuellen Lebensstils, für den man die Verantwortung nicht bei der Gesellschaft suchen sollte?
Zum Beispiel: Burn-out und Depression
Zur (amtlichen) Beantwortung der Frage gibt es jetzt aktuelles Material vom Bayerischen Landessozialgericht, das in einem Urteil feststellte (wie der DGB jüngst bekannt machte; vgl. DGB 2018, dort auch die Urteilsbegründung), dass psychische Erkrankungen aufgrund von Stress keine Berufskrankheiten sind. Denn – so die Begründung des Gerichts – im Falle von Erkrankungen, die möglicherweise auf Stress zurückzuführen seien, fehle es an den erforderlichen wissenschaftlichen Erkenntnissen. Insbesondere im Zusammenhang mit Burn-out und Depressionen werde eine Vielzahl von möglichen Ursachen diskutiert, so dass eine Zurückführung auf die Arbeitswelt nicht möglich sei. Dabei hielt das Gericht noch einmal den grundsätzlichen Sachverhalt fest, „dass laut SGB VII Berufskrankheiten nur solche Krankheiten sind, ‚die die Bundesregierung durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates als Berufskrankheiten bezeichnet‘. Diesen Statuts verdienen sie sich dadurch, dass sie ‚nach den Erkenntnissen der medizinischen Wissenschaft durch besondere Einwirkungen verursacht sind, denen bestimmte Personengruppen durch ihre versicherte Tätigkeit in erheblich höherem Grade als die übrige Bevölkerung ausgesetzt sind‘.“ (Schillo 2018)
Der wesentliche Punkt ist: Die Entscheidung fiel, nachdem ein Berufstätiger aus der Versicherungswirtschaft wegen unerträglichen Arbeitsdrucks und fortwährender Überlastung auf Anerkennung seiner psychischen Leiden als (bzw. Gleichbehandlung mit) einer Berufskrankheit geklagt und dazu umfangreiches Material vorgelegt hatte. Das Gericht wollte bezeichnender Weise die geschilderte Arbeitshetze und übermäßige Beanspruchung gar nicht bezweifeln, der „Vortrag des Klägers“ könne „vollumfänglich als zutreffend und wahr unterstellt werden“. Das half aber trotzdem nichts. Die Klage wurde abgelehnt, wobei die Begründung ganz einfach ging. In den staatlichen Listen seien die „geltend gemachten psychischen Erkrankungen“ nicht aufgeführt („Neurasthenie und schwere Depression ebenso wenig wie ein sog. Burnout-Syndrom“). Die schweren Leiden des Klägers könnten daher, so hieß es in der Begründung weiter, nach „den aktuellen Erkenntnissen der medizinischen Wissenschaft nicht kausal bestimmten ‚besonderen Einwirkungen‘ zugeordnet werden. Vielmehr wird eine Vielzahl von beruflichen, aber vor allem auch privaten, sozialen und genetischen Faktoren als Ursachen depressiver Störungen diskutiert, was in der Medizin mit dem Begriff der ‚Multikausalität‘ beschrieben wird.“ (DGB 2018)
Wie Cechura in seinem Buch grundsätzlich darlegt, ist das Skandalöse einer solchen Entscheidung nicht, dass es sich um einen Fehlgriff handelt. So sieht vielmehr der gängige gesundheitspolitische Umgang mit den medizinischen Fortschritten in Sachen Massenkrankheiten aus. Die gesellschaftliche Verursachung – beim Burn-out z.B. liegt ja die Verbindung zum Arbeitsleben glasklar auf der Hand – wird in den persönlichen Umgang mit den verschiedenen, scheinbar unvermeidlichen Risikofaktoren der modernen Industriegesellschaft verwandelt. Die Rechtslage hat das Bayerische Gericht korrekt exekutiert. Cechura weist darauf hin, dass Burn-out bislang noch nicht einmal in der Internationalen Klassifikation der Krankheiten (ICD) aufgeführt wird und somit keinen offiziellen Krankheitsstatus besitzt. Die Tatsache der Erschöpfung und Auspowerung im Arbeitsprozess wird natürlich von der Medizin nicht einfach ignoriert, sie hat auch schon zu einer bedingten Anerkennung unter anderen Titeln (früher als „vegetative Dystonie“, im heutigen ICD-Kanon als „somatoforme autonome Funktionsstörung“, F45.3, Version 2018) geführt.
Die medizinische Wissenschaft ist sich schon im Klaren darüber, wie das moderne Berufsleben funktioniert. Aber das hindert sie nicht daran, der Rechtsprechung den entscheidenden Gesichtspunkt zu liefern, nämlich den Zweifel, inwiefern und ob überhaupt Berufstätige wirklich Belastungen „in erheblich höherem Grade als die übrige Bevölkerung ausgesetzt sind“. Der Verschleiß von Gesundheit, Gemüt und Nervenkostüm ist nämlich an den Hochleistungsarbeitsplätzen des Kapitalstandorts D, der die Globalisierungskonkurrenz gewinnen will, eine Selbstverständlichkeit. Belastungen, die den Menschen komplett fordern, können – rechtlich – nicht als Krankheitsursache geltend gemacht werden, denn andere Teile der Belegschaft halten sie ja aus. Wie bei den Vergiftungen von Umwelt oder Lebensmitteln wird gesundheitspolitisch – so der Standpunkt der „Volksgesundheit“ – ein gewisser Level der Schädigung als normal und verkraftbar vorausgesetzt. Dass er vom kranken Individuum nicht mehr verkraftet wird, muss also per definitionem auf zusätzliche „Risikofaktoren“ (in der Hauptsache eben: auf den individuellen Lebensstil, für den der Einzelne Verantwortung trägt) zurückgeführt werden.
Mit dem Status einer Berufskrankheit sind bestimmte Versicherungsleistungen verbunden, die Ausnahme bleiben sollen. Da kennt der Sozialstaat keine Gnade. Im Fall des Burn-outs wird sogar der Staus einer Krankheit bezweifelt, einerseits. Andererseits wird natürlich die Unbrauchbarkeit eines Menschen für das Erwerbsleben nicht einfach übergangen. Und möglicher Weise findet das Krankheitsbild demnächst ja auch noch seine offizielle Anerkennung, wie von einigen Experten gefordert. Ähnliches gilt bzw. galt für den Fall der Depression (vgl. Cechura 208, 167ff). Auch hier hat man es mit einem allgemeinen Befund von Niedergeschlagenheit und Antriebslosigkeit zu tun, den ein moderner Arbeitnehmer leicht nachvollziehen kann. Am Feierabend sind halt „die Aggregate leer“, denn wie heißt der Wahlspruch der „Mitarbeiter im Verkauf“ von Aldi: „Dafür gebe ich jeden Tag mein Bestes“. Die emotionale schwermütige Verstimmung, die früher als „Melancholie“ ein Signum der „leisure class“ war und dann lange als begleitendes Symptom anderer Leiden galt, hat sich zu einer regelrechten Volkskrankheit gemausert – natürlich unter tatkräftiger Mithilfe der Pharmaindustrie, die mit Stimmungsaufhellern und Ähnlichem ein Bombengeschäft macht (vgl. Jurk 2008). „1970 war sie die am weitesten verbreitete psychische Störung der Welt… Gleichzeitig wird sie zu einer Modekrankheit, wenn nicht zur Jahrhundertkrankheit erklärt.“ (Ehrenberg 2008, 13)
Auch diese „affektive Störung“ (ICD, Version 2018, F30-F39) ist also erkennbar eine „Zivilisationskrankheit“, verdankt somit ihre Karriere der Durchsetzung einer kapitalistischen Konkurrenzordnung, in der der Einzelne seine Heimat finden soll und will. Im Falle der psychischen Störungen gilt aber tatsächlich, dass hier die Betreffenden nicht einfach den Härten der modernen Zivilisation ausgesetzt sind, sondern dass ihr eigener Wille einen entscheidenden Beitrag zur Genese leistet. Das registrieren Psychopathologie bzw. Psychiatrie auf ihre Weise, nämlich mit dem Befund, dass es hier um ein spezifisches Leiden geht, das sich nicht einfach in den normalen Verschleiß von Arbeitskraft auflöst.
Auch Cechura hält fest, dass Burn-out „nicht nur den Zustand einer körperlichen Überforderung kennzeichnet, sondern auch den Prozess, der daraus resultiert, dass Menschen in ihrer Arbeit einen Sinn sehen wollen, der nicht unbedingt mit dem zusammenfällt, was die Aufgabe im Betriebs- oder Behördenablauf beinhaltet. Wer seine Arbeit zu einem anerkennungswerten Beitrag zu einer Gemeinschaftsaufgabe in Betrieb oder Gesellschaft stilisiert, übersieht, dass es diese Gemeinschaftlichkeit so nicht gibt, allenfalls als eine Zwangsgemeinschaft mit meist gegensätzlichen Interessen. Wer so denkt, wird immer wieder damit konfrontiert, dass ihm sein Dienst nicht gedankt wird, weil die Vorgesetzten selbstverständlich davon ausgehen, dass jeder seine Arbeit gut verrichtet und seine Pflicht erfüllt, und ein spezielles Lob im Betrieb also nicht unbedingt auf der Tagesordnung steht. Wenn dann die Kollegen sich nicht genauso reinhängen wie man selbst und das dazu führt, dass sie dennoch genauso oder vielleicht sogar besser dastehen als man selbst, dann ist dies ebenso ein Grund zur Unzufriedenheit, die einen frustriert. So tritt neben die Anforderungen durch die Arbeit noch die Aufregung durch die Enttäuschung über die fehlende Realisierung des eigenen Ideals. Auch das belastet nicht nur die Psyche, sondern den gesamten Körper.“ (Cechura 2018, 165f)
Ähnliches gilt von der Depression. Sie zeichnet sich ebenfalls dadurch aus, dass sie nicht bloß einen Zustand der Erschöpfung darstellt. Sie geht nicht im Verschleiß von Arbeitskraft bzw. in den unvermeidlichen Folgen der damit verbundenen Rücksichtslosigkeit auf. Sie ist nicht nur Niedergeschlagenheit, sondern gedankliche Aktivität, mit der die Betreffenden sich ihre unerträgliche Lage ständig und ausschließlich vor Augen halten. Die zum Krankheitsbild dazugehörigen Schuldgefühle und Selbstanklagen zeigen, dass die hinzutretende Interpretation der eigenen Erschöpfung die entscheidende Rolle spielt, nämlich dazu motiviert, gedanklich nur noch um das eigene Versagen zu kreisen, bis sich dies ins Gefühlsleben einbrennt und entsprechende physiologische Folgen hervorbringt.
Im Blick auf die Genese solcher psychischen Störungen, könnte man also sagen, dass die Patienten individuelle Fehler machen. Es wäre aber der Gipfel des Zynismus, ihnen das, wie in der gängigen gesundheitspolitischen Einordnung praktiziert, als Resultat „privater Faktoren“ anzurechnen – so als könnte man sich durch die Wahl eines gesunden Lebensstils einfach vor solchen Erkrankungen schützen. Die Betreffenden wollen ja gerade funktionieren. Sie bemühen sich mit aller Verbissenheit und unter strengster Berücksichtigung der geltenden Erfolgsmaßstäbe, ihren Platz in der Konkurrenzordnung zu finden und sich dort zu bewähren; sie liefern pflichtbewusst Leistung ab, geben für das Wachstum ihrer Firma oder die Mehrung des nationalen Erfolgs das Letzte; kommen nicht dazu, das schützende „dicke Fell“ zu entwickeln, wozu Gesundheitsexperten raten (vgl. Bertelsmann 2013), sondern fühlen sich verantwortlich dafür, dass ihre Arbeit sinnvoll ist, und machen sich ein Gewissen aus den notwendig eintretenden Härten und Wechselfällen der Konkurrenz. Und in der Hinsicht kann man wirklich sagen, dass das moderne Erwerbsleben an einem auf Höchstleistung getrimmten Kapitalstandort die Menschen verrückt macht.
Nachweise
- Bertelsmann Stiftung (Pressemeldung), „Dickes Fell“ im Job kann vor Burn-out schützen – Psychische Widerstandsfähigkeit im Berufsleben lässt sich trainieren. In: Auswege-Magazin der GEW, 26. September 2013, online: https://www.magazin-auswege.de/2013/09/dickes-fell-kann-vor-burnout-schuetzen/.
- Suitbert Cechura, Unsere Gesellschaft macht krank – Die Leiden der Zivilisation und das Geschäft mit der Gesundheit. Baden-Baden 2018.
- DGB (Pressemeldung), Psychische Erkrankungen: Stress verursacht keine Berufskrankheit. In: Auswege-Magazin der GEW, 2. September 2018, online: https://www.magazin-auswege.de/2018/09/stress-verursacht-keine-berufskrankheit/.
- Alain Ehrenberg, Das erschöpfte Selbst – Depression und Gesellschaft in der Gegenwart. Frankfurt/M. 2008.
- IVA-Redaktion, Zur Kritik der Psychologie. In: IVA, Texte2016, April 2016, online: https://www.i-v-a.net/doku.php?id=texts16#zur_kritik_der_psychologie.
- Charlotte Jurk, Der niedergeschlagene Mensch. Depression – Geschichte und gesellschaftliche Bedeutung einer Diagnose. Münster 2008.
- Albert Krölls, Kritik der Psychologie – Das moderne Opium des Volkes. (Erstausgabe 2006) 3., akt. und erw. Aufl., Hamburg 2016.
- Johannes Schillo, Creydt kritisiert Krölls? In: IVA, Texte2016, April 2016, online: https://www.i-v-a.net/doku.php?id=texts16#creydt_kritisiert_kroells.
- Johannes Schillo, Burn-out? Selber schuld! „Zivilisationskrankheiten“ und ihre Ursachen. Auswege-Magazin der GEW, 10. September 2018, online: https://www.magazin-auswege.de/2018/09/burn-out-selber-schuld/.
- Michael Zander, Unhaltbare Polemik – Neuauflage von Albert Krölls’ „Kritik der Psychologie“ im VSA-Verlag erschienen. In: Junge Welt, 6.6. 2016.
Armut in einem reichen Land – ein Widerspruch?
Im Oktober erscheint „Der soziale Staat“ von Renate Dillmann und Arian Schiffer-Nasserie – keine Fortschreibung der Armutsforschung, sondern ein Angriff auf die inzwischen auch im reichen Deutschland etablierte Disziplin. Dazu eine Mitteilung der IVA-Redaktion.
Die beiden Autoren des Buchs halten Sozialpolitik nicht, wie sie in ihrer Ankündigung schreiben, „für eine unhinterfragbar gute Errungenschaft moderner Staatlichkeit, nur weil die ‚sozial Schwachen‘ in der ‚freien Marktwirtschaft‘ ohne sie kein Auskommen haben. Sie feiern den Sozialstaat nicht dafür, dass er der Garant für den ‚sozialen Frieden‘ und die ‚Nachhaltigkeit‘ der staatlich etablierten Konkurrenzgesellschaft ist.“ Ihre Darstellung zielt vielmehr „auf eine grundsätzliche Kritik: Sozialpolitik in Deutschland ist ein Armutszeugnis über die materielle Lebenslage der Lohnabhängigen, ein notwendig umstrittenes Funktionserfordernis im entwickelten Kapitalismus und zugleich ein Quell für ebenso viele wie falsche Erwartungen an den sozialen Staat.“ (Dillmann/Schiffer-Nasserie 2018)
Das Buch, das im Oktober bei VSA in Hamburg erscheint, soll am Samstag, dem 1. Dezember 2018, in Köln im Bürgerzentrum Alte Feuerwache vorgestellt werden. Dazu folgen demnächst genauere Angaben auf dieser Website unter „Termine“. Hier nur einige Hinweise im Blick darauf, wie sich Renate Dillmann und Arian Schiffer-Nasserie mit ihrer neuen Studie zu der – etablierten und kritischen – Armutsforschung stellen, die inzwischen auch im reichen Deutschland ihren festen Platz hat und der regierungsoffiziellen Berichterstattung in Sachen Soziales ihren Dienst leistet.
„Armut in einem reichen Land“
Existenzgrund der besonderen staatlichen Sorge in puncto Armut (in dem Buch ist vor allem die deutsche Situation Thema) sei nicht der Standpunkt der Hilfe, die sich einfach der Not der Armen und an den Rand Gedrängten zuwende, um das Ziel einer allgemeinen Wohlfahrt zu realisieren. Vielmehr gehe es darum, eine Konkurrenz- und Eigentumsordnung funktionstüchtig und haltbar zu machen. In einem Einleitungsteil führen die Autoren dies an der Ökonomie aus, um dann im ersten Hauptteil die Handlungsfelder des Sozialstaates vorzustellen. Der zweite Hauptteil widmet sich den historischen Etappen – von der industriellen Revolution zu Beginn des 19. Jahrhunderts und den Anfängen der Armenfürsorge im preußischen Staat über die Entstehung der Arbeiterbewegung und die Bismarckschen Sozialreformen, über Krieg, Krise, Faschismus und den Neuanfang in der Ära des Kalten Kriegs bis hin zur Agenda 2010.
Diese Agenda setzte die rotgrüne Koalition von 2003 bis 2005 um und damit der deutschen Sozialpolitik ein neues Datum, das Ende 2005 in der Regierungserklärung der neuen Kanzlerin Merkel gleich seine Bekräftigung fand – ein politischer Kurs, der schon damals Kritik hervorrief, der aber in der Praxis zum unbestrittenen Erfolgsweg des Standorts D und zum europapolitischen Vorbild obendrein wurde. Zu den prominenten Kritikern gehörte von Anfang an der Kölner Politikwissenschaftler und Armutsforscher Christoph Butterwegge, der später durch seine (von der Linkspartei betriebene) Kandidatur für das Amt des Bundespräsidenten bekannt wurde. Butterwegge legte 2005 seine Studie „Krise und Zukunft des Sozialstaates“ vor, die angesichts des damaligen Reformprojekts einen gesellschaftspolitischen „Systemwechsel“ diagnostizierte (Butterwegge 2005, 35). Hier finde, so sein Vorwurf, eine „neoliberalen Wende“ statt, die das „Ende des Wohlfahrtsstaates“ bedeute; der Sozialstaat werde „seit Mitte der 1970-er Jahre restrukturiert und demontiert, obwohl er weder Verursacher der damaligen Weltwirtschafts- und der im Grunde bis heute anhaltenden Beschäftigungskrise war, noch aus seinem Um- bzw. Abbau irgendein Nutzen für die wirtschaftliche oder gesellschaftliche Entwicklung des Landes erwächst.“ (Ebd., 5)
Der rotgrünen Politik stellte Butterwegge also kein gutes Zeugnis aus, wollte sie dabei aber nicht ganz verdammen. Sie habe eine Modernisierung des sozialstaatlichen Politikfeldes „im Sinne des Neoliberalismus bewirkt, ohne ihm programmatisch durchgängig und pauschal verhaftet zu sein.“ (Ebd., 231) Trotz „verschlechterter Ausgangsbedingungen“ böten sich hier „auch künftig noch Möglichkeiten für linksoppositionelle, gewerkschaftlich orientierte und globalisierungskritische Kräfte, die Reformen weiterzutreiben [!] und sie längerfristig mittels eigener Konzepte zur Umgestaltung von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft selbst stärker zu beeinflussen.“ (Ebd.) Eine bemerkenswerte Einschränkung (die Butterwegge übrigens in den späteren Auflagen seines Buchs beibehielt) bei der Verurteilung der diagnostizierten „neoliberalen Wende“! Zu deren Vollzug formulierte Butterwegge, wie gesagt, scharf: „Bei der heutigen ’Umbau’-Diskussion handelt es sich um einen politischen Frontalangriff auf den Sozialstaat in seiner gewohnten Gestalt. Es geht längst nicht mehr um bloße Leistungskürzungen, sondern um einen Systemwechsel.“ (Ebd., 35) Gleichzeitig erschien aber die Politik von Schröder, Fischer und Co. mehr als eine verhängnisvolle Fortsetzung der liberalkonservativen Transformationspolitik aus der Ära Kohl denn als Programm aus eigenem Antrieb, sie war gewissermaßen fremdverursacht. Die harsche Kritik des Armutsforschers unterließ es nicht, in solchen eindeutig klassifizierten Prozessen immer wieder die Momente aufzufinden, die Anknüpfungspunkte für widerständige oder alternative Bestrebungen bilden könnten. So wurden bei den festgestellten realen Tendenzen gleichzeitig meist die Möglichkeiten zu anderen, ja völlig entgegen gesetzten Lösungen thematisiert.
Das ist ein erstaunliches Anliegen, radikale Kritik am (sozialen) Zustand der Republik zu üben und dies gleichzeitig damit zu verbinden, Chancen der Verbesserung und Umkehr in den verschiedensten politischen Lagern ausfindig zu machen. In der Tat, dazu passt die Entscheidung der Linkspartei, einen solchen Ankläger der sozialen Verhältnisse als Kandidaten fürs Präsidentenamt zu präsentieren. Der Bundespräsident muss schließlich alle Deutschen repräsentieren und sich um den gesellschaftlichen Zusammenhalt kümmern. Dazu passt auch, dass Butterwegge seine Klage gleich mit dem Hinweis auf einen anderen, im Grunde viel größeren Missstand – kurz gefasst: „Sozialstaat und Demokratie am Ende?“ (Butterwegge 2015, 15) – verband und ihr damit die eigentliche Schärfe gab. „Arme sind nicht nur sozial benachteiligt, vielmehr in aller Regel auch politisch weniger aktiv, skeptischer gegenüber der parlamentarischen Demokratie, die sie häufig für ihre prekäre Lage (mit)verantwortlich machen, und seltener bereit, wählen zu gehen.“ (Ebd.) Dass Arme das bestehende politische System für ihre Lage verantwortlich machen könnten, hält Butterwegge für die zentrale Gefahr, der man entgegen treten müsste! Natürlich vor allem aus Sorge darum, dass derjenige, der „dem parlamentarischen Repräsentativsystem bzw. seinen Institutionen misstraut, auch leicht rechtsextremen bzw. -populistischen Demagogen auf(sitzt)“ (ebd., 16).
Butterwegge ist ein Kenner aller einschlägigen Armutslagen, er hat die Härtefälle von Kindern, Alten, Alleinerziehenden (Butterwegge/Klundt/Zeng 2005, Butterwegge 2005, Butterwegge/Bosbach/Birkwald 2012), die historischen Zusammenhänge (Butterwegge 2014) oder die politischen und medialen Beschönigungs- oder Anpassungsstrategien (Butterwegge 2009, 2016) untersucht. Er weiß auch, dass man es bei Armut mit einer Art Systemeigenschaft der Marktwirtschaft zu tun hat: „Soziale Ungleichheit (ist) aufgrund des bei Unternehmern konzentrierten Privateigentums an Produktionsmitteln und der weitgehenden Mittellosigkeit vieler Arbeitskraftbesitzer für kapitalistische Industriegesellschaften konstitutiv.“ (Butterwegge 2015, 10) So klingt zwar Systemkritik an, ein „Aber“ folgt jedoch gleich auf dem Fuße: „Um die globale Finanz-, Weltwirtschafts- und Währungskrise erklären sowie ihre Ursachen, Erscheinungsformen und negativen Folgen für das politische System der Bundesrepublik begreifen zu können, muss man aber das Wesen und die spezifischen Charakterzüge des Gegenwartskapitalismus berücksichtigen. Verantwortlich für die schwerste Wirtschafts- und Finanzkrise seit dem Zweiten Weltkrieg sind nicht bloß der Kapitalismus als solcher und die ihm eigene Tendenz zur Überakkumulation bzw. Überproduktion im Rahmen 'normaler' Konjunkturzyklen, sondern auch seine jüngsten Strukturveränderungen. Anknüpfend an die Charakterisierung früherer Entwicklungsphasen dieser Wirtschaftsordnung als 'Handels-' und 'Industriekapitalismus' ist meist von 'Finanzmarktkapitalismus' die Rede.“ (Ebd., 10f)
Butterwegge weiß auch, dass der Sozialstaat keine demokratische Errungenschaft ist, sondern aus anderen Zeiten stammt, dass er eben von der preußischen Monarchie über Bismarck und Hitler bis zum Adenauerstaat als politisches Erfordernis seine Anerkennung gefunden hat. Das „goldene Zeitalter“ des „Wohlfahrtsstaates“ beginnt bei Butterwegge in seiner großen Analyse von 2005 bezeichnender Weise mit dem Kaiserreich. Und es sind auch oft Zeiten des nationalen Schulterschlusses gegen einen äußeren Feind, die die Politik an die Lage der Arbeiterklasse denken lassen. „Kaum zu überschätzen ist die Bedeutung des Ersten Weltkriegs für das spätere Aufblühen des Wohlfahrtsstaates. Schon bald nach Kriegsbeginn im August 1914 erhielt die deutsche Sozialpolitik einen mächtigen Schub, der sich nicht zuletzt auf die Notwendigkeit gründete, im Zeichen des sog. Burgfriedens alle Kräfte, auch jene der oppositionellen Arbeiterbewegung, für die ‚Verteidigung des Vaterlandes‘, genauer gesagt: die Kriegsziele der Hohenzollernmonarchie, zu mobilisieren, was nur gelingen konnte, wenn man Sozialdemokratie und Gewerkschaften zumindest neutralisierte.“ (Butterwegge 2005, 47)
Zur Kritik der Armutsforschung
Alle kritikwürdigen Sachverhalte kommen bei Butterwegge zur Sprache: Seit rund 200 Jahren betreut die Politik, in Form der unterschiedlichsten Regime, den Gegensatz von Kapital und Arbeit, macht das auf diesem Antagonismus basierende System haltbar, blamiert alle Ideale eines bürger- bzw. arbeiterfreundlichen „Wohlfahrtsstaates“, ja zeigt, dass die säkulare Tendenz zu Beginn des 21. Jahrhunderts wieder in Richtung der erschreckenden Elends-Zustände aus dem „Manchesterkapitalismus“ weist (wie die kritische Armutsforschung, Butterwegge vorneweg, minutiös bilanziert) – und all das unterliegt dem Urteil, dass es eigentlich nicht so sein müsste. Die Marktwirtschaft, so die Auflösung, bietet einen Spielraum, mit dem bei kluger wirtschaftspolitischer Steuerung ungute „Strukturveränderungen“ der letzten Zeit wieder rückgängig gemacht werden könnten. Der Sozialstaat wäre ein Instrument, das man – Vertrauen in die demokratischen Institutionen vorausgesetzt – für diese Aufgabe benutzen könnte. Den eigentlich Gegner, der kaltzustellen wäre, hätte man in einer neoliberalen Ideologie vor sich, die aus reiner Bösartigkeit & Verblendung auf den Sozialstaat eindrischt und ihm (siehe oben) in Form fehlgeleiteter Politik einen „Um- bzw. Abbau“ verpasst, ohne dass daraus „irgendein Nutzen für die wirtschaftliche oder gesellschaftliche Entwicklung des Landes erwächst“. Im Interesse des hiesigen Wirtschaftswachstums müsste man ihn also gerade erhalten.
Diese Doppeldeutigkeit geht bis zu den jüngsten Einlassungen, die der Armutsforscher Butterwegge zu gesellschaftspolitischen Herausforderungen abgibt, so etwa zur „Digitalisierung“, die von anderen Zeitgenossen in kritischer Absicht als Gefährdung von Millionen Arbeitsplätzen, als „digitaler Tsunami“ (so der Philosoph Precht), herausgestellt wird. Butterwegge hält das für eine „wahnsinnige Übertreibung“, eine „neoliberale Erzählung“. Im Interview (General-Anzeiger, 4.9.2018) erklärt er, warum: „Bei der Mechanisierung, der Elektrifizierung, der Motorisierung und der Computerisierung wurden auch solche Horrorszenarien an die Wand gemalt – und sie sind nie eingetreten. Bei all diesen Prozessen sind am Ende mehr Arbeitsplätze entstanden. Warum sollte das bei der Digitalisierung nicht so sein?“ Dass der Einsatz von Technologie Arbeitskraft erspart, weiß zwar auch Butterwegge, ein wichtiger Punkt sei „bei diesem Thema aber, dass es viel mehr berufliche Umschulungen und Weiterbildungsmaßnehmen geben muss… Da liegt der Schlüssel – Arbeitsminister Heil sieht das ähnlich“, Merkel übrigens auch. Wie überhaupt das ganze Statement zu den gängigen neoliberalen Erzählstunden passt: Erstens sind Arbeitsplätze (bzw. die Chancen darauf) das größte Versprechen, das man zu erwarten hat. Zweitens: Ihre Besetzung ist natürlich eine Frage der individuellen Qualifikation; wer bei der Weiterbildung, beim Imperativ des „lebenslangen Lernens“, schlampt, braucht sich über Arbeitslosigkeit nicht zu wundern. Dazu muss drittens der Staat einiges an Bildungsmöglichkeiten bereitstellen, was man hier aber nicht als Kritik an fehlender politischer Initiative missverstehen soll, da Butterwegge sich gleich mit dem Arbeitsminister einig weiß…
Kritik an dieser Art, das Vertrauen in den Sozialstaat hochzuhalten – ein Vertrauen, das sich wie die soziale Politik selber gleichgültig stellt gegen den Existenzgrund einer solchen speziellen hoheitlichen Dienstleistung und gegen die Widersprüche, die damit exekutiert werden –, ist gelegentlich laut geworden. Butterwegge hat das großzügig ignoriert. Manfred Henle bemerkte etwa zu Butterwegges – mittlerweile in 5. Auflage (2014) vorliegendem – Sozialstaatsbuch: „Butterwegges Plädoyer für einen ‚zukunftsfähigen Sozialstaat‘ (2005, 289-300) mit ‚Bürgerversicherung‘ und einem menschenwürdigen ‚Existenzminimum‘ (2005, 295) ist der erklärte Verzicht auf eine Analyse der dem Sozialstaat immanenten Gleichgültigkeit. Das hat die Studie gemein mit den rechtskonservativ-neoliberal-globalisierungskritischen Sozialstaatstheoretikern und -praktikern – ob sie sich dessen bewusst ist oder nicht.“ (Henle 2006, 53) Arian Schiffer-Nasserie, Co-Autor der angezeigten kritischen Analyse, schrieb zu Butterwegges Veröffentlichung „Armut in einem reichen Land“, dass man zwar ganz konstruktiv wie die vorgelegte Publikation den Ausbau der Sozialversicherung hin zu einem armutsfesten, bedarfsdeckenden und repressionsfreien System fordern könne, dass man sich aber schon mit dieser bescheidenen Zielsetzung rasch den Vorwurf zuziehe, „völlig fehlgeleitet das Unmögliche zu verlangen“ (Schiffer-Nasserie 2009, 305). Statt den eigenen Idealismus weiter zu pflegen, sollte man daher besser einmal den Einwänden nachgehen, die in der bestehenden Marktwirtschaft keine ernsthafte Verbesserungsmöglichkeit sehen wollen. Nimmt man die jüngste Aussage zur Digitalisierung, so scheint Butterwegge aber mittlerweile bestrebt, dem Publikum soziale Sorgen auszureden und ihm das Vertrauen in die sozialdemokratische Arbeitsmarktpolitik zurückzugeben.
So reduziert sich wirklich die ganze Bilanz der kritischen Armutsforschung dieses Typs auf die Sorge, dass die Regierenden möglicher Weise den Zusammenhalt der Gesellschaft aufs Spiel setzen. Das Buch „Der soziale Staat“ will solche Erklärungen angreifen und seine Thesen bei der Veranstaltung im Dezember zur Diskussion stellen:
- 1. Wachsende Armut in Deutschland ist kein Tatbestand, den es in der marktwirtschaftlichen Ordnung eigentlich gar nicht geben dürfte, und auch kein Resultat regierungsamtlicher Versäumnisse. Armut ist vielmehr Ausgangs- und Endpunkt lohnabhängiger Beschäftigung, gehört zu dieser kapitalistischen Gesellschaft also immer dazu. Armut und Reichtum sind auch nicht „soziale Unterschiede“ beim Geldverdienen; die Armut der einen ist vielmehr das Mittel der anderen, ihren Reichtum zu vergrößern. Und die Politik hat mit ihren Hartz-IV-Beschlüssen das heutige Niveau von Armut zielgerichtet hergestellt, um ihre Bevölkerung für den Konkurrenzkampf der deutschen Exportnation herzurichten.
- 2. Angesichts dieses Sachverhalts Gefahren für den „sozialen Zusammenhalt“ zu beschwören, kritisiert Armut nicht vom Standpunkt der Geschädigten, sondern nimmt umgekehrt die Gefahren in den Blick, die die Armen für den ungestörten Fortbestand der Gesellschaft darstellen: Arme lassen sich hängen, erziehen ihre Kinder nicht zu Anstrengung und Leistungsbereitschaft, wählen falsch, kümmern sich nicht um Weiterbildung (siehe „Digitalisierung“!). Die gemeine Perspektive dieser Kritik: Nicht die Armen haben ein Problem mit der Armut und der Gesellschaft, die sie arm macht, sondern die Politik hat ein Problem mit den Armen.
- 3. Die Armutsforschung in Deutschland ist eine Ansammlung ideologischer Konstrukte. Armut ist nämlich keine Frage der Definition, sie ist mit einer Einkommensgrenze unter 50 Prozent des mittleren Einkommens völlig falsch bestimmt und sie ist auf keinen Fall das Resultat einer „unterschiedlichen Einkommensverteilung“. Armut ist die Folge gegensätzlicher Einkommensquellen, die auf dem Ausschluss der Lohnabhängigen von den Mitteln der Reichtumsproduktion und von den Produkten ihrer Arbeit beruhen.
- 4. Das neue Ausmaß der Armut ist deshalb auch gar kein Widerspruch zum Wirtschaftswachstum „in einem reichen Land“. Im Gegenteil: Die Politik hat mit ihren Agenda 2010-Beschlüssen das heutige Niveau von Armut zielgerichtet und im vollen Bewusstsein der Konsequenzen hergestellt, dafür den seit bald 150 Jahren immer wieder neu justierten Sozialstaat nicht abgeschafft, sondern rücksichtslos eingesetzt und seinen Maßnahmenkatalog dem Konkurrenzkampf im Globalisierungszeitalter angepasst.
Literatur
Christoph Butterwegge/Michael Klundt/Matthias Zeng (Hg.), Kinderarmut in Ost- und Westdeutschland. Wiesbaden 2005.
Christoph Butterwegge, Krise und Zukunft des Sozialstaates. Wiesbaden 2005.
Christoph Butterwegge/Gerd Bosbach/Matthias W. Birkwald (Hg.), Armut im Alter – Probleme und Perspektiven der sozialen Sicherung. Frankfurt/M. 2012.
Christoph Butterwegge, Armut in einem reichen Land – Wie das Problem verharmlost und verdrängt wird. Frankfurt/M. u. New York 2009.
Christoph Butterwegge, Hartz IV und die Folgen – Auf dem Weg in eine andere Republik? Weinheim 2014.
Christoph Butterwegge, Wachsende soziale Ungleichheit – eine Gefahr für die Demokratie. In: Journal für politische Bildung, Nr. 1, 2015, S. 10-18.
Christoph Butterwegge, Reichtumsförderung statt Armutsbekämpfung – Eine sozial- und steuerpolitische Halbzeitbilanz der Großen Koalition. Wiesbaden 2016.
Renate Dillmann/Arian Schiffer-Nasserie, Der soziale Staat – Über nützliche Armut und ihre Verwaltung. Hamburg 2018. Homepage: http://renatedillmann.de/. (Siehe die Ankündigung unter der IVA-Rubrik „Bücher“ bzw. die Verlagsseite: https://www.vsa-verlag.de/nc/buecher/detail/artikel/der-soziale-staat/.)
Manfred Henle, Soziale Krise und Sozialstaat. In: Praxis Politische Bildung, Nr. 1, 2006, S. 51-53.
Arian Schiffer-Nasserie, Armutsforschung. In: Praxis Politische Bildung, Nr. 4, 2009, S. 303-305.
John McCains Verdienste
„Does John McCain deserve all this? Is the attention real attention, or just hype? Is there a difference?“ David Foster Wallace: Up, Simba, 2000
März
„Marx is back“, Vol. 10
IVA hat im letzten Jahr die merkwürdige Betriebsamkeit in Sachen Marx-Jubiläum dokumentiert und mit einigen Anmerkungen versehen, die vor allem auf die pädagogische Praxis Bezug nahmen (siehe „Marx is back“, Vol. 1-9). Hier eine Nachbemerkung der IVA-Redaktion zum Abschluss der Reihe.
Das Marx-Jubiläum – 2017: 150 Jahre „Das Kapital“, 2018: der 200. Geburtstag von Karl Marx – hat, wie sollte es beim Abfeiern runder Jahreszahlen anders sein, zu einer Reihe eigenartiger bis bizarrer Erscheinungen geführt. Von der chinesischen KP über den deutschen Bundespräsidenten bis zur SPD-nahen Ebert-Stiftung und zum Trierer Dommuseum haben sich die disparatesten Figuren und Motive ans Werk gemacht, einen – irgendwie und trotz allem – großen Deutschen aus dem 19. Jahrhundert zu ehren und dabei der Kapitalismuskritik die letzten Zähne zu ziehen. Auf derartige Trends hatte die IVA-Reihe „Marx is back“ aufmerksam gemacht und daneben einige Hinweise gegeben, welche Materialien, Termine, Vorgänge für diejenigen, die in der pädagogischen Arbeit engagiert sind, von Interesse sein könnten.
Diese Reihe wird hiermit abgeschlossen. IVA plant aber, in 2018 auf das Thema zurückzukommen. So soll zunächst eine ausführliche Auseinandersetzung mit der modernen Marx-Widerlegung erfolgen, die sich ja nicht mehr wie zu Zeiten des Kalten Kriegs in der kategorischen Absage an einen verblendeten Denker und einer Kampfansage an das „Gift“ des Marxismus-Leninismus erschöpft. In den neueren Würdigungen wird Marx – was man vielleicht als den gemeinsamen Nenner bezeichnen kann – für interessant befunden, um dann die unterschiedlichsten Schlüsse zu ziehen. Für den Mainstream ist dabei klar, dass hier – bestenfalls – ein Querdenker aus dem 19. Jahrhundert einige Anregungen geben kann, wie die ökonomische Entwicklung im Rückblick zu betrachten und auf die zukünftigen Herausforderungen hin auszurichten ist. Ein ernsthaftes Interesse an der Marxschen Theorie ist dabei nicht zu verzeichnen, auf Ausnahmen von diesem Trend hatte die IVA-Reihe ebenfalls hingewiesen.
Marx – ein „erloschener Vulkan“, ein „toter Hund“?
Als einen weiteren Schritt plant IVA, auf die pädagogischen Fragen zurückzukommen (zu den Diskussions- und Bildungsveranstaltungen, an denen sich IVA beteiligt, siehe die Rubrik „Termine“). Im Bildungsbetrieb, vom Geschichtsunterricht (vgl. Gemein 2018) bis zu den Akademien der Erwachsenenbildung (vgl. Schillo 2017), ist das Thema ja angekommen. Es gab schon den Scherz, Karl Marx sei nicht nur Stammgast im Feuilleton, sondern zum „Lieblingsautor der Evangelischen Akademien“ geworden (vgl. Urban 2017, 94). Das ist etwas übertrieben, aber die Evangelische Akademie Frankfurt bietet gleich am 15. März 2018 eine paradigmatische Veranstaltung an: Marx im Spannungsfeld von Auslaufmodell und Zukunftsimpuls (siehe: http://www.evangelische-akademie.de/kalender/karl-marx-auslaufmodell-oder-impulsgeber-fuer-die-zukunft/). Dazu sind als Referenten die Professoren Sonja Buckel (Politische Theorie/Universität Kassel) und Rainer Forst (Politische Theorie und Philosophie/Universität Frankfurt) sowie Ulrike Herrmann, Wirtschaftskorrespondentin der „taz“, eingeladen.
In der Ankündigung der Frankfurter Veranstaltung (die in Kooperation mit der Friedrich-Ebert-Stiftung und wohl auch unter deren Regie stattfindet) heißt es zu Marx, das runde Datum 2018 sei „ein Anlass, aber nicht der Grund für eine neue Beschäftigung mit seiner Person und seinem Werk. Vor rund 50 Jahren berief sich noch die halbe Welt auf diesen Denker – der Kommunismus war ihm ebenso verpflichtet wie die Sozialistischen und Sozialdemokratischen Parteien weltweit. Mit der Epochenwende 1989/90 schien sein Werk dann obsolet zu sein. Aber sind die Vulkane des Marxismus wirklich erloschen, wie Niklas Luhmann einst meinte?“ (Zum Thema erloschene Vulkane gibt es jetzt übrigens auch den interessanten Film „Lava“ von Pixar, was Luhmann leider nicht mehr erleben konnte: https://www.youtube.com/watch?v=XwYgcbGZ91A.)
Angesichts dieser Vereinnahmungsversuche fragt Hans-Jürgen Urban vom Vorstand der IG Metall (Urban 2017, 94f), ob wir heute etwa alle Marxisten seien, und antwortet: „Wohl kaum. Die Gewerkschaften des Gegenwartskapitalismus, die deutschen allzumal, sind es jedenfalls nicht. Sie behandeln den radikalen Kapitalismustheoretiker als jenen ‚toten Hund‘, als den Marx selbst einst seinen philosophischen Lehrmeister Hegel durch das ‚Epigonentum‘ seiner Zeit behandelt sah. Jedenfalls endet die Recherche nach angemessenen gewerkschaftlichen Publikationen oder Veranstaltungen zum 150. Geburtstag des (ersten Bandes des) ‚Kapital‘ oder zum 200. Geburtstag des Autors weitestgehend ohne Befund“. In der Tat, da, wo man mit Marx wirklich etwas anfangen könnte, tut sich nicht viel. Von IVA hat es seit 2016 zwar einige Marx-Seminare bei der DGB-Jugend gegeben und am 26. Mai 2018, nach Eröffnung der großen Landesausstellung, soll ein Seminar „Marx heute: Kapital, Geld und Ware“ des DGB in Trier folgen (siehe im Netz: http://trier.dgb.de/termine/++co++8cf82fe8-0104-11e8-b6a5-52540088cada, dazu demnächst genauere Angaben bei IVA). Auch in GEW-Publikationen wurde an einigen Stellen darauf hingewiesen (vgl. Bernhardt/Gospodarek 2017). Aber mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein ist das nicht.
Urban hat sein Plädoyer für eine ernsthafte Befassung mit der Marxschen Kapitalismuskritik und deren Bedeutung für die gewerkschaftliche Praxis in der Zeitschrift „Luxemburg“ der Rosa-Luxemburg-Stiftung veröffentlicht (das Heft steht auch zum kostenlosen Download bereit – siehe unter Nachweise). Von der Stiftung sind verschiedene Materialien erarbeitet worden, worauf die IVA-Reihe „Marx is back“ bereits hingewiesen hat. Und ihre Bildungswerke bieten natürlich zahlreiche Veranstaltungen an. Dabei steht meist die Aktualität der Marxschen Theorie im Vordergrund. Das macht einen deutlichen Unterschied zur Ebert-Stiftung, die im Besitz des Karl-Marx-Hauses in Trier ist und damit gewissermaßen die Hoheit über die einschlägige Erinnerungskultur beansprucht. Die Ebert-Stiftung setzt mit den Ausstellungsaktivitäten, wie sie mitteilt, auf den Dreiklang von „Historisierung, Entpolitisierung und Entideologisierung“ (Bouvier 2018, 8). In diesem Sinne will sie in Kooperation mit dem Verband der Geschichtslehrer Deutschlands (VGD) „schülergerechtes“ didaktisches Material erarbeiten, das voraussichtlich zum Frühjahr 2018 vorliegen wird. In der Ankündigung (siehe die VGD-Zeitschrift „Geschichte für heute“, 1/18) wird allerdings betont, dass dabei eine „Fortführung bis in die Gegenwart“ beabsichtigt ist („Marx und die Finanzkrise etc.“).
Entsprechendes Material für die Sekundarstufe II hat Gisbert Gemein vorgelegt, wobei sein knapper „Grundriss“ mehr auf die Wirkungsgeschichte von Marx und Engels abhebt. In den Mittelpunkt rückt er „das, was aus ihren Schriften gemacht wurde“ (Gemein 2018, 22). Im außerschulischen Bereich der Jugend- und Erwachsenenbildung besteht natürlich eine größere Freiheit, mit dem Thema umzugehen – falls Pädagoge und Pädagogin sie sich denn nehmen wollen. Dazu gibt es verschiedene Vorschläge, auf die hier abschließend kurz hingewiesen sei. Sie betreffen die politische Bildung (vgl. Anger 2017, Schillo 2018). Diese ist im Schulbereich sehr unter Druck und wird dort, wie eine neue Vergleichsstudie der Universität Bielefeld von Ende Januar 2018 zeigte (vgl. Auswege-Magazin 2018), sowieso auf ein Minimum reduziert. „Gelehrt wird stattdessen Wirtschaft“, hieß es in einem Interview mit dem Politikdidaktiker Reinhold Hedtke (Hedtke 2018). Hedtke wies gleichzeitig darauf hin, dass es durchaus Unterschiede zwischen den einzelnen Bundesländern gebe. Generell aber – das hat Hedtke schon in verschiedenen Statements thematisiert – ist ein Trend zu verzeichnen, der erstens die Frage nach der Wirtschaftsordnung am liebsten ganz aus der politischen Bildung verbannen möchte und zweitens auf ein Fach Wirtschaftskunde abzielt, das sich ganz stromlinienförmig auf die Kompetenzen marktwirtschaftlicher Akteure konzentrieren soll. Ware-Geld-Beziehungen werden somit zur conditio sine qua non wirtschaftlichen Handelns; sie – möglicher Weise noch in kritischer Absicht – als theoretisches Problem zur Diskussion zu stellen, erübrigt sich dann, denn der Nachwuchs soll allein in der Handhabung dieser Notwendigkeiten seine Zukunft sehen.
Und so wird das ja im Normalfall gesehen. Der Pädagoge Franz Anger hat in seinem Beitrag darauf aufmerksam gemacht, dass Schule heute durchgängig in einer solchen Weise organisiert ist. Bildungsökonomisch gesprochen geht es heutzutage ganz selbstverständlich um die Aufbereitung eines „Humankapitals“, das sich unterm Leitbild der „Employability“ um seine Verwertung auf dem Arbeitsmarkt zu kümmern hat (Anger 2018, 75). Wird dem mit der Marxschen Erklärung der trostlosen Rolle von „klein v“ – also des „variablen Kapitals“, d.h. der Ware Arbeitskraft, die dem Produktionsprozess wegen ihrer variablen, den Wert vergrößernden Potenz einverleibt wird – entgegen und nahe getreten, beschweren sich Anhänger der Marktwirtschaft gerne darüber, dass hier Menschen zur Ware erklärt oder lauter weltfremde und schwer verständliche Theorien aufgestellt werden.
Die Erwachsenenpädagogin Stephanie Hürtgen berichtet dagegen aus der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit (Hürtgen 2018), dass schon die ersten, auf einem hohen Abstraktionsniveau angesiedelten Bestimmungen des „Kapital“ – so die Unterscheidung zwischen abstrakter und konkreter Arbeit im ersten Kapitel des ersten Bandes – für moderne Belegschaften unmittelbar nachzuvollziehen und auf die Erfahrungen mit ihrem betrieblichen Alltag anzuwenden sind. Zwar haben einige der Marxschen Beispiele aus der Arbeitswelt – was Hürtgen zu bedenken gibt (Hürtgen 2018, 101f) – einen altertümlichen, noch am Handwerk orientierten Charakter, doch die Analyse des ökonomischen Verhältnisses von Kapital und Arbeit treffe nach wie vor ins Schwarze. So kann man auch gegenwärtig den Kollegen und Kolleginnen am Übergang zur legendären „Arbeitswelt 4.0“ empfehlen, einmal zurück zum Original zu gehen statt sich die Marxschen Erklärungen in den verballhornten Fassungen ihrer Erneuerer, Überwinder oder Widerleger anzutun.
Nachweise
- Franz Anger, Politische Bildung mit Marx? Zur Aktualität einer verdrängten Theorie. In: Journal für politische Bildung, Nr. 4, 2017, S. 74-76.
- Auswege-Magazin, „Drei Kulturen politischer Bildung an deutschen Schulen“ – Sozialwissenschaftler der Universität Bielefeld erstellen Ranking. In: GEW-Magazin „Auswege – Perspektiven für den Erziehungsalltag“, 2. Februar 2018, http://www.magazin-auswege.de/2018/02/drei-kulturen-politischer-bildung-an-deutschen-schulen/.
- Frank Bernhardt/Rudolf Gospodarek: ‚Marx is back‘ – zur Aktualität seiner Analysen. In: hlz – Zeitschrift der GEW Hamburg, Nr. 3-4, 2017, S. 47-49.
- Beatrix Bouvier, Karl Marx in der neueren Forschung. In: Geschichte für heute – Zeitschrift für historisch-politische Bildung, Nr. 1, 2018, S. 5-20.
- Gisbert Gemein, Marxismus im Unterricht – ein Grundriss. In: Geschichte für heute – Zeitschrift für historisch-politische Bildung, Nr. 1, 2018, S. 22-38.
- Reinhold Hedtke, „Klassen, die in der Schulzeit nie Politik hatten“ – Interview. In: Junge Welt, 5. Februar 2018.
- Stephanie Hürtgen, Kampf ums Konkrete – Der „Doppelcharakter der Arbeit“ und die Gewerkschaften. In: Luxemburg, Nr. 2/3, 2017, S. 100-107.
- Johannes Schillo, Mit Luther, Marx & Papst contra Kapitalismus? Zur Wiederentdeckung der Marxschen Theorie. In: Erwachsenenbildung, Nr. 3, 2017, S. 136-137.
- Johannes Schillo, Marx ist wieder da! Zur Aktualität seiner Kapitalismuskritik. In: Außerschulische Bildung, Nr. 1, 2018, S. 44-47.
- Hans-Jürgen Urban, Der tote Hund als Berater – Warum die Gewerkschaften öfter mal Marx fragen sollten. In: Luxemburg, Nr. 2/3, 2017, S. 94-99. (Kostenloses Download des Heftes, das dem Marx-Jubiläum gewidmet ist, unter: https://www.zeitschrift-luxemburg.de/.)