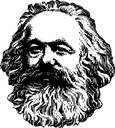Inhaltsverzeichnis
Textbeiträge 2024
An dieser Stelle veröffentlichen wir Texte und Debattenbeiträge. Wer Anmerkungen dazu hat, wende sich an die IVA-Redaktion (siehe „Kontakt“).
April
Red & Black Books
Die IVA-Redaktion hat bereits mehrfach auf Publikationen hingewiesen, die Hermann Lueer bei Red & Black Books herausbringt. Hier eine Aktualisierung.
Hermann Lueer gibt seit einigen Jahren in seinem Verlag Red & Black Books Bücher heraus, die sich mit der Geschichte der Arbeiterbewegung befassen, vor allem mit den abweichenden Tendenzen, die sich gegen den Mainstream von SPD und Gewerkschaften richteten und die etwa der rätekommunistischen Strömung zuzuordnen sind. Dazu gehörte z. B. die Streitschrift „Klassenkampf und Nation“ des Rätekommunisten Anton Pannekoek aus dem Jahr 1912.
Über Pannekoeks Schrift hieß es im Gewerkschaftsforum Anfang 2023, rückblickend aufs abgelaufene Jahr mit seiner Ausrufung einer „Zeitenwende“ durch einen sozialdemokratischen Kanzler: Ein weiterer Blick – mehr als 100 Jahre – zurück auf die Wende von 1914, als sich die Arbeiterbewegung auf den Weg ins Zeitalter der Weltkriege begab, könnte auch Pannekoeks wieder aufgelegtes Pamphlet in den Blick nehmen. Die Neuausgabe der Streitschrift rufe eine historische Zeitenwende in Erinnerung, nämlich die Zäsur, als die Arbeiterbewegung ihre Kapitalismuskritik beendete und aus ihrer internationalistischen Programmatik heraus den Weg zur Bejahung der Nation fand, somit das „Zeitalter der Extreme“ (Eric Hobsbawm) möglich machte.
Dazu hieß es weiter: „Der Rückblick auf den Rätekommunisten Pannekoek erinnerte auch daran, dass man im Grunde den sozialistischen Parteien Europas, allen voran der SPD, die Hauptschuld für das gegenseitige Abschlachten der Nationen geben müsse. Denn ohne die Entscheidung der Partei- und der mit ihr verbundenen Gewerkschaftsführung – Bewilligung der Kriegsanleihen und Ausrufung eines inneren ‚Burgfriedens‘ – und ohne die nachfolgende Bereitschaft der Arbeitermassen, in den imperialistischen Krieg ihrer Herren zu ziehen, wäre es nicht gelungen, die Völker für vier lange Jahre gegeneinander in Stellung zu bringen.“
Der Verlag Red & Black Books hat jetzt eine eigene Website: https://redblackbooks.de/
Dort werden auch die älteren Publikationen angezeigt, z. B. Hermann Lueers Schrift „Warum sterben täglich Menschen im Krieg“. Diese „Argumente gegen die Liebe zur Nation“ erschienen ursprünglich 2010. Sie liegen jetzt in der zweiten Auflage (2020) vor. Neu erschienen ist im April 2024 folgende Publikation: David Adam, „Die Arbeitszeitrechnung und das Absterben des Staates – Beiträge zur Kritik gängiger Irrtümer“ (ISBN 978-3-9825825-2-8, Hardcover, 161 Seiten, 18 €). Das Buch setzt sich mit der Wertkritik auseinander, wie sie in der BRD vor allem durch Robert Kurz bekannt gemacht wurde. Der Verlag teilt zu dieser neuen Aufsatzsammlung mit:
„Marx und Engels haben die Grundprinzipien der Alternative zum Kapitalismus in Übereinstimmung mit ihrer Kapitalismuskritik klar formuliert:
- Die Arbeitszeitrechnung ist die unvermeidliche ökonomische Grundlage der kommunistischen Gesellschaft.
- Die Kommune ist die politische Form, unter der die ökonomische Befreiung der Arbeit sich vollziehen kann.
Libertäre Kapitalismuskritiker mögen diese Alternative nicht. Sie wollen in einer Gesellschaft leben, aber frei von ihr sein. Die Theoretiker dieser modernen Form des utopischen Sozialismus reformulieren ‚die zentralen Kategorien der Marxschen Kritik der politischen Ökonomie …, um die Grundlage für eine radikalkritische begriffliche Neubestimmung des Wesens der zeitgenössischen kapitalistischen Gesellschaft zu schaffen.‘ (Moishe Postone)
David Adam zeigt in den hier versammelten Aufsätzen, dass diese ‚Reformulierung der zentralen Kategorien der Marxschen Kritik der politischen Ökonomie‘ durch die Vertreter der sogenannten Wertkritik, schlicht auf einem falschen Verständnis der Marxschen Wertkritik beruht und dass über diese Revision der Marxschen Kapitalismuskritik zugleich eine ernsthafte Auseinandersetzung mit der Frage der ökonomischen Lebensfähigkeit einer sozialistischen Gesellschaft verhindert wird, indem sie dazu verleitet, die ‚Selbstverwaltung‘ auf der Grundlage der Arbeitszeitrechnung als eine Art kapitalistisches Programm zu betrachten.“
Die Red & Black Books können über die neue Website direkt beim Verlag bestellt werden.
Zur innerlinken Feindbildpflege
Was die Politik im Großen kann, können linke Menschen auch im Kleinen – nämlich ein Bild der moralischen Verkommenheit ihrer Gegner zeichnen, dass es nur so kracht. Dazu ein Hinweis der IVA-Redaktion.
Die Website //Contradictio//, das „Schwarze Brett“ des Gegenstandpunkts, hat Anfang April eine Reihe von Veranstaltungen angekündigt, die unter dem Motto „Der Ruf nach Frieden ist verkehrt!“ standen und die sich mit den Aufrufen zu den diesjährigen Ostermärschen auseinandersetzten – kritisch, wie an den Veranstaltungsankündigungen gleich erkennbar war. Dass in den Resten der ehemals machtvollen deutschen Friedensbewegung oder in deren Umkreis Einspruch laut wird, der versucht, antimilitaristische, antiimperialistische und antikapitalistische Positionen stark zu machen, ist an sich keine Neuigkeit. Die IVA-Website hatte bereits im letzten Jahr unter dem Titel „Ukrainekrieg: Die Jasager und die Neinsager“ (Texte2023, August) auf diverse Initiativen und Wortmeldungen hingewiesen. Diesen Einspruch könnte man etwa unter der Losung „Absage an die Kriegsherren – statt um Frieden bitten“ zusammenfassen.
Zuletzt hatte IVA kurz vor Beginn der diesjährigen Ostermärsche die Initiative „Wer den Kapitalismus nicht kritisieren will, sollte vom Frieden schweigen“ vorgestellt (siehe Texte2024, März), die in dieselbe Richtung zielte. Sie blieb in der Protestszene nicht ganz unbeachtet, wobei jedoch festzuhalten ist, dass der Mainstream der heutigen Friedensbewegung ganz unbeirrt weiter darauf setzt, den (leider nicht mehr sehr breiten) Friedenswunsch der Bevölkerung an die Regierenden zu adressieren und bessere, nämlich soziale Verwendungsweisen der in die Rüstung zu investierenden Milliarden vorzuschlagen. Auch die Versuche von marxistisch-leninistischer oder trotzkistischer Seite, im Gewand einer Neuen Friedensbewegung aufzutreten, haben daran nichts geändert bzw. sich dem bündnispolitisch zugeordnet.
Ein Feindbild mit Tradition
Mit den Ankündigungen auf Contradictio wurde nun eine Kontroverse losgetreten, die anscheinend immer noch nicht beendet und mittlerweile auf fast 40 Beiträge angewachsen ist. Es sei davon abgeraten, diese Kontroverse im Einzelnen nachzuverfolgen. Wer sich einen Eindruck davon verschaffen will, womit man es hier zu tun hat, lese den Startschuss von Rudolf Radler und etwa das, was Karla Kritikus 30 Wortmeldungen später immer noch an verzweifelten Bemühungen unternimmt, um zum sachlichen Kern der Gegenstandpunkt-Kritik zurückzukehren. Radler eröffnete den Streit am 4. April mit einer wütenden Anklage gegen kritische Interventionen in die gegenwärtige Friedensbewegung: Hier solle dem letzten Rest von Protest eine „Klatsche“ erteilt werden mit der Message „Alle doof, außer ich“ und dem Ziel, politische Aktivität zu unterbinden. Das wurde dann von El Che aufgegriffen und in eine ganze Litanei von Anklagen verlängert, die vor allem darauf zielten, dass die Zeitschrift Gegenstandpunkt ein einziges Politikverhinderungsunternehmen sei.
Mit einem Wust von Halbwissen über das Agieren einzelner Personen und den Kreis der Unterstützer wurde hier ein Sittengemälde entworfen, das der klassischen Feindbildkonstruktion entspricht. Wie in der großen Politik heutzutage ein Putin als Inkarnation des Bösen gilt, der im Innern immer nur unterdrücken und nach außen seine Macht möglichst weit ausdehnen will, so soll hier eine Führung sich ihre Anhängerschaft gefügig machen, um damit dann bei der Restlinken die letzten Regungen von Protest zu unterbinden. Wie gesagt, das ist leicht als moralische Diskreditierung erkennbar, die übrigens im Rahmen der ausufernden Contradictio-Kontroverse rasch ins Schleudern kam, wenn einmal die Stichhaltigkeit einzelner Vorwürfe überprüft werden sollte.
Leider muss man hier aber eins ergänzen: Neu ist dieses Feindbild nicht. Seit den legendären Zeiten der Marxistischen Gruppe (MG), dem Vorläufer des Gegenstandpunkts, kursieren solche Vorwürfe. Sie waren etwa eine Domäne der Deutschen Kommunistischen Partei (DKP), speziell als diese sich in den 1980er-Jahren ganz dem Friedenskampf verschrieb und sich dabei – bevor Gorbatschow der real existierenden sozialistischen Systemalternative den Todesstoß versetzte – fast aufrieb (siehe dazu: „Imperialismus gestern und heute“, IVA, Texte2023, November). Eine radikale Kritik am westdeutschen Imperialismus, hieß es damals, lasse Politik- und Eingriffsfähigkeit vermissen; angesagt sei vielmehr die Bereitschaft, sich ins breite Bündnis der um Friedenswahrung besorgten Bevölkerung einzureihen. Ausgestorben ist diese Kritik im Umkreis der DKP heutzutage nicht, obwohl sie dort eher von exzentrischen Figuren vorgetragen wird, z.B. vom Marxisten-Leninisten Marlon Grohn.
Der hat 2019 das Buch „Kommunismus für Erwachsene: Linkes Bewusstsein und die Wirklichkeit des Sozialismus“ (Verlag Das Neue Berlin) veröffentlicht. In der Rezension der UZ (14.2.2020) hieß es dazu, der Anspruch des Buchs, sich an Erwachsene zu richten, ziele „auf Leser, die es mit dem Kommunismus ernst meinen – und das heißt praktisch: mit der Errichtung, Entwicklung und Verteidigung des Sozialismus als langfristig notwendiger Übergangsgesellschaft. Dementsprechend viel Platz verwendet Grohn daher auf das Abarbeiten an linken, im Grunde antikommunistischen Strömungen wie Wertkritik, Antideutschtum, Rätekommunismus oder Anarchismus“. Oder eben Gegenstandpunkt.
Dazu ein Beispiel dieser gnadenlosen Kritik (wobei die sprachlichen Eigenheiten nicht korrigiert wurden). Der Autor nimmt u.a. eine „commünistische“ Herrschaftskritik ins Visier, die den seinerzeit real existierenden Sozialismus nicht als die maßgebliche Realität zur Kenntnis genommen, sondern ihn mit linksradikalen Ideen konfrontiert habe. Damit habe man sich um „Erfordernisse von Möglichkeiten der materiellen Änderung der Welt herumgedruckst.“ (S. 140) Im Unterschied zu Realisten seien solche Kritiker „einfach nicht in den Stande der geistigen Gesittung getreten und weigern sich vehement, es zu tun.“ Der Autor fährt fort: „Der besonders stark von diesem Wahn befallene Karl Held (der sich als westdeutscher Marxologe zeit seines Lebens für einen Kommunisten hielt und bis heute noch von haufenweise Linken für einen solchen gehalten wird) brachte es mit seiner der organisierten Irrationalität zuzurechnenden Gruppierung ‚GegenStandpunkt‘ sogar fertig, das Argument gegen das Erfolgsargument in der linksradikalen Szene salon-, bzw. barackenfähig zu machen: dem Verweis von Realisten auf die schlichte Tatsache, dass die linksemanzipatorischen Vorstellungen sich niemals durchgesetzt hätten, und zwar notwendigerweise, entgegnete er, dies sei ein ‚Erfolgsargument‘ und deshalb das ‚gemeinste‘, also unzulässig – was ihn und seine Anhängerschaft aber nie davon abhielt, sich selbst andauernd dieses ‚Erfolgsarguments‘ zu bedienen, wenn es ihnen in ihren ideologischen Kram passte: Die DDR sei gescheitert, weil die Politik dort keinen Erfolg gehabt habe, da sehe man mal wieder, dass der Bolschewismus nicht funktioniere.“
Alles klar? Zumindest das Feindbild wird erkennbar: Man hat es beim Gegenstandpunkt mit Typen ohne geistige Gesittung zu tun, denen es gar nicht um Veränderung geht, die sich mit lauter Besserwisserei im Bestehenden einrichten und die denjenigen, die wirklich etwas verändern wollen, in die Parade fahren. Der UZ gefiel das, einerseits. „So wird etwa die ‚argumentidealistische Gruppierung GegenStandpunkt‘ nebenbei in einer Fußnote unter Verweis auf Marx’ und Engels’ Widerlegung der Bakuninisten erledigt“, schrieb Rezensent Christopher Tracy. Er ging aber andererseits doch auf eine gewisse Distanz, da realistische Ansätze zur Weltveränderung in dem Buch zu kurz kämen und „Grohns konkrete Maßnahmenvorschläge sich auf ‚das begriffsreiche stalinistische Pöbeln gegen andere Linke‘, also weitere Polemik, beschränken.“ Anschluss an Stalin kommt heute vielleicht bei unzufriedenen deutschen Bürgern nicht so gut an…
Was tun?
Auf Contradictio ist natürlich an die Diskussionsteilnehmer appelliert worden, Schmähungen, die auf persönliche Dinge oder rhetorische Fähigkeiten zielen, zu unterlassen und sich nur zum sachlichen Kern der Kontroverse zu äußern. Und gegen einen solchen Imperativ ist auch nichts einzuwenden. Das Problem ist nur, dass er bei denjenigen, die von der Güte der eigenen Mission beseelt sind und die Notwendigkeit sehen, dem Gegner die Maske vom Gesicht zu reißen und die bösen Absichten beim Namen zu nennen, wenig ausrichten wird. An dieser Stelle kann aber IVA – ausnahmsweise – einmal einen ganz konstruktiven und praktischen Vorschlag machen, was sich hier tun lässt. Man kann nämlich der Internetplattform //99:1// eine Spende zukommen lassen.
Die Leute von 99:1, die sich auch in der besagten Kontroverse kurz zu Wort gemeldet haben, organisieren seit einigen Jahren solche Diskussionen. Sie wollen nicht ein linkes Allerlei bieten, sondern setzen bewusst darauf, dass Standpunkte und Gegenstandpunkte ihre Differenzen austragen. Während sich also sonst der linke „Diskursraum“ verengt – die einzige linke Publikumszeitschrift Konkret z.B Autoren aussortiert, die sich anderswo kritisch zur israelischen Politik äußern, oder das Online-Magazin Telepolis nicht mehr Teil der Gegenöffentlichkeit, sondern eine Art Ergänzung des normalen Medienbetriebs sein will –, bietet 99:1 dem erfreulicher Weise die Stirn. Wer kann, sollte das materiell unterstützen.
März
Wer den Kapitalismus nicht kritisieren will, sollte vom Frieden schweigen
Rudolf Netzsch hat Ende 2023 eine Veröffentlichung zu Klimakatastrophe und -protest vorgelegt und jetzt mit einem Flugblatt zur Vorbereitung der diesjährigen Ostermärsche Stellung genommen. Hier der Text des Flugblatts.
Was ist Frieden?
Betrachtet man die Geschichte der – sagen wir einmal – letzten zweihundert Jahre, so kann man zu dem Schluss kommen:
Frieden, das sind die Zeiten, in denen Kriegsgründe geschaffen werden.
Klingt sarkastisch. Vielleicht fragt ihr jetzt irritiert: Soll uns das denn davon abhalten, für den Frieden einzutreten, Verhandlungen zu fordern? Klar, Krieg ist furchtbar und seine Beendigung zu fordern deshalb nie verkehrt. Nur sollte man darauf achten, in der Argumentation nicht zu kurz zu greifen. Wer bloß ganz allgemein Verhandlungen als die bessere Alternative benennt, verpasst das Entscheidende. Sehen wir uns einmal an, worüber unter Außenpolitikern verhandelt wird. Da drängt sich die Antwort auf: über Kriegsgründe! Denn es ist doch auffällig:
- Jedem Krieg gehen Verhandlungen voraus.
- Jeder Krieg wird durch Verhandlungen beendet
- Bei allen Verhandlungen steht die militärische Stärke und Position der Verhandlungspartner – zumindest als der redensartliche Elefant – im Raum.
- Während des Kriegs ist es üblich, militärische Ziele so zu bestimmen, dass sie einen möglichst guten Ausgangspunkt für eventuelle Verhandlungen bieten.
Friedliche Verhandlungen und kriegerische Feldzüge sind also engstens miteinander verzahnt. Die entscheidende Frage lautet daher: Was sind die Gründe, die die Staaten ständig zueinander in Gegnerschaft bringen, so dass sie immer wieder streiten, zunächst in Verhandlungen und vor internationalen Institutionen, aber am Ende auch auf den Kriegsschauplätzen? Geht es um die berühmten „Werte“? Nun ja, mit Blick darauf, wie selektiv dieses Argument gebraucht wird, glauben wohl nur wenige wirklich ganz fest daran – und doch greifen fast alle gern darauf zurück, wenn es darum geht, die eigene Parteinahme zu begründen. Deutlich plausibler ist da schon der Hinweis auf wirtschaftliche Interessen, auch wenn mancher sich scheut, das direkt auszusprechen.
Denn es ist die Wirtschaft, durch die die Staaten untereinander in Abhängigkeiten geraten: Sie benötigen und benutzen sich wechselseitig als Rohstofflieferanten, Absatzmärkte und Arbeitskräftereservoir und das führt unweigerlich zu Konflikten. Freilich ist das nicht so zu verstehen, dass jeder Staat, der sich irgendwie von einem anderen wirtschaftlich benachteiligt fühlt, gleich zu den Waffen greift. Da befände sich längst jedes Land im Krieg mit jedem anderen. Vielmehr wird erst einmal „schiedlich friedlich“ um möglichst günstige Zugriffsbedingungen auf Reichtum und Ressourcen der anderen Nationen gefeilscht.
Alle Staaten treten als Betreuer ihres jeweiligen nationalen Kapitalstandorts auf und werden so zu Konkurrenten am kapitalistischen Weltmarkt, der inzwischen – nach dem Abdanken des sozialistischen Blocks – tatsächlich „global“ geworden ist. Der Ostblock wollte nicht mitmachen und wurde deshalb totgerüstet. Jetzt sind alle Staaten kapitalistisch verfasst und nehmen an der Weltmarktkonkurrenz so gut sie können teil, um nicht zum Verlierer zu werden, was Konsequenzen hätte bis hin zum Absturz als „failed state“. In dieser Konkurrenz wird vor allem die Stärke als Wirtschaftsstandort – aber auch als Militärmacht! – in Anschlag gebracht. Da spürt jeder Staat schnell die Begrenztheit seiner eigenen Möglichkeiten und versucht, sich mit anderen zu Bündnissen zusammen zu schließen. Das Ergebnis ist bekannt: Die ganze Welt teilt sich in „Blöcke“ auf, die gegeneinander „geostrategische“ Interessen verfolgen.
Was ist also der Grund für diese ständig kriegsträchtige Situation? Es ist die kapitalistische Gesellschaftsordnung, die zwangsläufig und gesetzmäßig zu diesem Zustand führt. Das Fazit heißt: Wer den Kapitalismus nicht kritisieren will, der sollte vom Frieden schweigen.
Zur Weiterführung hier ein paar aktuelle Buchtipps:
1) Wer bezweifelt, dass mit „Putin!“ wirklich alles gesagt ist, und stattdessen wissen will, was es mit der „regelbasierten Weltordnung“ hinsichtlich der Kriegsgründe letztlich auf sich hat, dem seien folgende Analysen zu Politik und Presse im Ukraine-Krieg empfohlen: Renate Dillmann, Abweichendes zum Ukraine-Krieg. 2023. Vertrieb über Amazon, ISBN 978-3982027791.
2) Wen ein ungutes Gefühl darüber beschleicht, wie die Frage von Krieg und Frieden anlässlich des Ukraine-Kriegs mit neuer, erschreckender Schärfe und mit lautem Säbelrasseln in der deutschen Öffentlichkeit behandelt wird, dem sei empfohlen: Norbert Wohlfahrt/Johannes Schillo, Deutsche Kriegsmoral auf dem Vormarsch – Lektionen in patriotischem Denken über »westliche Werte«. Hamburg 2023, ISBN 978-3-96488-188-5.
3) Wer das Gesagte ins Verhältnis zur Klimafrage setzen will und sich z.B. darüber wundert, dass es für die „feministische“ Außenministerin von den Grünen vordringlicher ist, „Russland zu ruinieren“ als den Klimaschutz voran zu treiben, dem sei empfohlen: Rudolf Netzsch, Nicht nur das Klima spielt verrückt – Über das geistige Klima in dieser Gesellschaft und die fatalen Folgen für das wirkliche Klima der Welt. München 2023, ISBN 978-3-8316-2420-1.
Ein Dissident der deutschen Arbeiterbewegung
Die Website Rätekommunismus veröffentlicht Texte aus der Geschichte der Arbeiterbewegung, die vor allem mit der Zäsur des Jahres 1914 zu tun haben. Dazu ein Hinweis der IVA-Redaktion.
Auf der Website raetekommunismus.de sind z.B. Texte von Anton Pannekoek und von der Gruppe Internationaler Kommunisten (GIK), die seinerzeit die Rätekorrespondenz herausgab, wieder zugänglich gemacht worden – und liegen teilweise auch in Printversion vor. Zuletzt wurden verschiedene Schriften von Julian Borchardt veröffentlicht (siehe auch „Die Zeitenwende – Eine historische Parallele?“ https://www.i-v-a.net/doku.php?id=texts23#die_zeitenwende_eine_historische_parallele).
Der Weg ins Zeitalter der Weltkriege
Der 1868 in Bromberg, dem heutigen polnischen Bydgoszcz, geborene Borchardt wurde nach seinem Studium der Volkswirtschaft in Brüssel Redakteur verschiedener sozialdemokratischer Zeitungen in Deutschland und war zeitweise Abgeordneter der SPD im preußischen Landtag. Außerdem versuchte er als „Wanderprediger“ die Grundlagen der sozialistischen Kritik unter die einfache Bevölkerung zu tragen. In den Jahren 1913 und 1914 wurde sein Verhältnis zur SPD immer angespannter, da er die parteikritische Zeitschrift Lichtstrahlen (https://www.raetekommunismus.de/Texte_Borchardt.html) herausgab.
Ein Hinweis auf den grundlegenden Charakter des Konfliktes zwischen Borchardt und der Mehrheit der Sozialdemokratie findet sich im Leitartikel „Neue Wege“ der Lichtstrahlen vom Juni 1914: „Aber das wissen wir, dass nur die Massen sich selbst befreien können; kein anderer kann das für sie tun. Dann aber versteht es sich, dass alle heutige Tätigkeit darauf abzielen muss, die Massen für diese ihre schließliche Selbstbefreiung vorzubereiten und zu ‚ertüchtigen‘. Das aber sind keine neuen Wege, sondern es ist der alte Weg, auf dem allein das Proletariat bisher wirklich vorwärtsgekommen ist. Er heißt: keine falschen, übertriebenen Hoffnungen auf die großen Männer setzen, ob mit oder ohne Abgeordnetenmandat, sondern selbst denken, selbst wollen, selbst handeln. Massenaufrüttelung, Massenbegeisterung, Massenbewegung, das ist die Bahn zum Erfolge.“
Anton Pannekoek, Karl Radek, Edwin Hoernle, Franz Mehring und Johann Knief gehörten zu den bekanntesten Autoren der oppositionellen Zeitschrift. Der endgültige Bruch mit der Partei erfolgte dann mit der Zustimmung der SPD-Mehrheit zu den Kriegskrediten am 4. August 1914. In seiner Broschüre „Vor und nach dem 4. August 1914“ (https://www.raetekommunismus.de/Texte_Borchardt/Borchardt_vor-und-nach-14-August.pdf) erklärte Borchardt die Unvereinbarkeit des Kampfes für den Sozialismus mit dem aktuellen Verhalten der Sozialdemokratie. 1916 wurde die Zeitschrift Lichtstrahlen verboten, Borchardt in Schutzhaft genommen. Die Zeit nutzte er, um Studien u.a. zur Finanzierung des Krieges zu betreiben (siehe „Woher kommt das Geld zum Kriege?“, Leipzig 1916 ).
Allerdings gab es in dieser Zeit auch heftige Auseinandersetzungen mit anderen Linksradikalen, vor allem mit der Arbeiterpolitik in Bremen, die Borchardt vorwarf, die Propaganda für den U-Boot-Krieg gegen England durch eine Vorbemerkung zu Karl Erdmanns Buch „England und die Sozialdemokratie“ unterstützt zu haben. Nach dem Krieg wurde die Veröffentlichung der Lichtstrahlen sofort wieder aufgenommen. Ihre Bedeutung reichte aber nicht mehr an die Zeit zu Beginn des Krieges heran, so dass die Zeitschrift im Jahre 1921 – auch wegen fehlender Finanzierungsmöglichkeiten – eingestellt werden musste.
Borchardt verfolgte wohlwollend die Oktoberrevolution in Russland. In ihr sah er die Möglichkeit einer sozialistischen Umgestaltung (siehe z.B. https://www.raetekommunismus.de/Texte_Borchardt/Borchardt_Diktatur_des_Proletariats.pdf). Dennoch kritisierte er Gewaltexzesse der Bolschewiki während der Revolution. Im Jahre 1919 veröffentlichte Borchardt kürzere Beiträge zu Grundfragen der kommunistischen Kritik, so über die volkswirtschaftlichen Grundbegriffe nach der Lehre von Karl Marx oder eine Einführung in den wissenschaftlichen Sozialismus. Diese Schriften beruhten auf den Vorträgen, die er vor dem Ersten Weltkrieg gehalten hatte. Die wohl bekannteste Veröffentlichung Borchardts ist seine gemeinverständliche Ausgabe des „Kapital“ von Karl Marx aus dem Jahre 1920. In viele Sprachen übersetzt, kann sie noch heute als eine wichtige Einführungsschrift, verfasst „in einfacher Sprache“, betrachtet werden.
Deutsche Geschichte
In den folgenden Jahren beschäftigte sich Borchardt vor allem mit geschichtlichen Fragen. Zwei Bände „Deutsche Wirtschaftsgeschichte“ erschienen in den Jahren 1922 und 1924, ab 1927 plante Borchardt eine kritische Bestandsaufnahme der allgemeinen deutschen Geschichte vom Ende des Dreißigjährigen Krieges bis zur Gegenwart. Zwar wird in verschiedenen Publikationen diese Schrift erwähnt, aber eine Veröffentlichung ist bisher noch nicht zustande gekommen. In den Archiven des Internationalen Instituts für soziale Geschichte in Amsterdam haben nun die Herausgeber Ippers, Jacobitz und Königshofen, Mitarbeiter der Rätekommunismus-Website, Fragmente des Manuskripts ausfindig gemacht und den ersten Band der „Deutschen Geschichte“ veröffentlicht.
Borchardt blickt hier – stilistisch wie inhaltlich respektlos – auf die Herrschaften in der Zeit nach dem Dreißigjährigen Krieg zurück. Seine Sicht auf die Geschichte unterscheidet sich erheblich von der üblichen Geschichtsschreibung vor und nach dem Ersten Weltkrieg, die die Triebkräfte der Geschichte in den guten und schlechten Charakteren der Fürsten, Könige und Kaiser vorzufinden glaubte. Borchardt hingegen untersucht die konkreten politischen und ökonomischen Umstände der damaligen Zeit und erklärt so die geschichtlichen Abläufe.
Die damalige bürgerliche Geschichtsschreibung folgte der nationalmoralischen Leitlinie, die Staatsverfassung und das Staatshandeln des deutschen Kaiserreiches vor dem Ersten Weltkrieg als Konsequenz der Politik der Hohenzollern-Dynastie zu verklären. Da blieb es nicht aus, dass die Historiker manche Purzelbäume schlagen mussten, wenn sie Intrigen und Bestechungen, Kriege und die gnadenlose Ausbeutung der armen Bevölkerung als geniale Schachzüge charakterisierten und so mit einem Heiligenschein versahen. Besonders ärgerte es Borchardt, dass durch die Geschichtsverfälschungen und -verdrehungen auch noch die Jugend in der Weimarer Republik verseucht wurde, um sie zu stolzen Staatsbürgern zu erziehen.
Die Herausgeber vermerken hierzu allerdings kritisch, dass Borchardt in der Geschichte eine fast mystische Kraft der Vorwärtsentwicklung am Werk sah. Ganz dem historischen Materialismus verpflichtet, bewertete er die Entstehung des Nationalstaates als eine notwendige Voraussetzung für die revolutionäre Umgestaltung der sich entwickelnden bürgerlichen Gesellschaft, alles getreu dem quasi vorherbestimmten Schema „Feudalismus – Kapitalismus – Sozialismus“ folgend. Da bekam z.B. Ludwig XIV., der den vaterländischen Geschichtsschreibern Deutschlands einfach nur als raubgieriger Herrscher galt, ein dickes Lob, weil er beim Aufbau des Absolutismus die widerstreitenden Provinzen Frankreichs zu einem Staatsganzen zusammenführte und somit die Bedingungen der Industrialisierung in Frankreich schuf. Hingegen verhinderte die kleinkrämerische Kleinstaaterei der deutschen Fürsten unter einem machtlosen Kaiser in Wien eine derartige Entwicklung, war also in dieser geschichtlichen Perspektive Feind des Fortschritts.
Natürlich war Borchardt klar, was diese progressive Entwicklung für die neu entstandene Klasse der Lohnarbeiter bedeutete: Die fast unvorstellbare Not der arbeitenden Bevölkerung beruhte auf dem Gegensatz von Lohnarbeit und Kapital. Aber durch dieses Jammertal mussten die Proletarier eben durch, wollten sie als Klasse das Licht der Freiheit und des Wohlergehens im Sozialismus erleben. So gesehen bewegte sich der mutige Außenseiter Borchardt dann doch wieder im Rahmen dessen, was damals in sozialdemokratischen Kreisen (aber auch mit Abwandlungen im Leninismus) als marxistische Theorie galt.
Nachweise
Website Rätekommunismus: https://www.raetekommunismus.de/
Karl Marx, Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie. Gemeinverständliche Ausgabe, besorgt von Julian Borchardt. Berlin 1920/1931, online verfügbar bei: https://www.raetekommunismus.de/Texte_Borchardt/Borchardt_1920_1931_Kapital.pdf
Julian Borchardt, Deutsche Geschichte - Band I: Die zweite Hälfte des 17. Jahrhunderts. Neu herausgegeben von Ursuala Ippers/Hans-Peter Jacobitz/Thomas Königshofen. Neuss 2024, 237 Seiten, ISBN 979-8879492408, erhältlich bei Amazon https://www.amazon.de/Deutsche-Geschichte-zweite-H%C3%A4lfte-Jahrhunderts/dp/B0CVNHP1N1
Februar
Der Fall Guérot III
Der „Fall“ der Politik-Professorin Guérot, die von der Bonner Universität wegen Fehlverhaltens entlassen wurde, war bei IVA 2023 bereits Thema. Dazu hier einige Publikationshinweise von Johannes Schillo.
Die Meinungsbildung in Zeiten des Kriegs geht ihre eigenen Wege. In Deutschland hat hier nach der von Kanzler Scholz angesagten „Zeitenwende“ eine regelrechte Gesinnungswende gegriffen. Die Öffentlichkeit ist eben als Vierte Gewalt im Staate vorgesehen und hat dementsprechend ihre staatstragende Rolle zu spielen – was im demokratischen Kapitalismus nichts Neues darstellt. Die Linke kann ein Lied davon singen, woran das Overton-Magazin 2022 in seiner „Zeitreise zu den 68ern“ ( Staatstreue Medien contra Dissidenz – auch im „freien Westen“? ) erinnerte.
Renate Dillmann hat das in der Jungen Welt (13.1.2024) am Beispiel der jüngsten militärischen Entwicklungen in Nahost aufgegriffen und betont, dass die Öffentlichkeit das „Ganz ohne Zensur“ (https://www.jungewelt.de/artikel/466880.gaza-krieg-ganz-ohne-zensur.html?sstr=Dillmann) hinkriegt. Auch hier gab es „von Anfang an eine nationale Leitlinie“. Dies wurde von den etablierten Medien, so Dillmann, aber nicht „als Anschlag auf ihre viel gerühmte Freiheit begriffen, sondern als Auftrag wahrgenommen. Sie haben sich darin ebenso als Medium bewährt, das die Vermittlung zwischen Staat und Bürgern gewährleistet, wie als vierte Gewalt im Staat, auf die Verlass ist. Das alles ohne staatliche Gleichschaltung und zentrale Direktive. Gespenstisch!“
Und erstaunlich ist dabei zudem, wie wenig heute an Abweichung von der gängigen Kriegsbereitschaft und Kriegsmoral genügt, um bei den Machern der Öffentlichkeit, um bei Behörden oder auch, wie im Fall des Medien- und Wissenschaftsbetriebs, bei eilfertigen Kollegen unangenehm aufzufallen. Der Beitrag über die „Hermeneutik des Verdachts“ in der Jungen Welt vom 20.12.2023 ist dem im Einzelnen nachgegangen und hat als prominentes Beispiel auch den „Fall Guérot“ herausgestellt.
Dokumentation einer Hexenjagd
An diesem Fall zeigt sich, wie (zivil-)gesellschaftliche Wachsamkeit unter der gegebenen nationalen Leitlinie dazu führt, dass dann doch noch im klassischen Sinne von den Behörden maßregelnd eingegriffen wird. Da bekommen nämlich „Professoren, die als Anhänger des ‚freien Meinens‘ im Wissenschaftsbetrieb den einen oder anderen kritischen Traktat veröffentlicht haben, zu spüren, dass sich ihre Wissenschaft ebenfalls unter den herrschenden politischen Konsens zu beugen hat“, schreibt Freerk Huisken in seiner Flugschrift „Frieden“ (2023, 84). Huisken kommt hier anschließend auf den Bonner Fall zusprechen und zitiert den Kündigungsbeschluss des Unirektorats. Dort hieß es, die Freiheit von Forschung und Lehre sei „ein Privileg, das jedoch auch mit großer Verantwortung einhergeht“. Huisken kommentiert: „Und ‚große Verantwortung‘ besteht darin, ohne Maßregelung und Zensur von oben der richtigen Parteilichkeit das wissenschaftliche Gewand zu verpassen.“
Worum geht es? Ulrike Guérot, Politik-Professorin an der Universität Bonn, hatte zusammen mit dem Wissenschaftler Hauke Ritz Ende 2022 das Buch „Endspiel Europa“ vorgelegt, das sich unter anderem dafür einsetzte, dass die deutsche Politik beim Ukrainekrieg die Möglichkeiten von Friedensverhandlungen auslotet, statt auf Kriegslogik zu setzen. Damit kam eine Kampagne gegen die Hochschullehrerin, die vorher schon die staatliche Seuchenbekämpfung kritisiert hatte, richtig auf Touren, und zwar mit dem Tenor: Wissenschaftlich sei eine solche – angeblich – prorussische Position untragbar. Und plötzlich verdichteten sich Plagiatsvorwürfe, deren Relevanz noch nicht geklärt ist, die sich im Einzelfall eher als kleinlichste Mäkelei erweisen.
Und sie erweisen sich, wie die sachkundigen Beiträge von Wissenschaftlern in dem neuen, von Gabriele Gysi herausgegebenen Sammelband „Der Fall Ulrike Guérot“ darlegen, als vorgeschobene Gründe, um störende Wortmeldungen in der Öffentlichkeit zum Schweigen zu bringen. Die Hochschullehrerinnen Heike Enger und Anke Uhlenwinkel, die ein Forschungsprojekt zu Maßregelungen im deutschsprachigen Wissenschaftsbetrieb betreuen, sprechen von einem „Eingriff in die verfassungsrechtlich garantierte Wissenschaftsfreiheit“ (Gysi, 15). Zwar hätten einschlägige disziplinarische Maßnahmen in den letzten Jahren überhaupt zugenommen, aber was hier geschehe, sei ein „einmaliger Vorgang“ (Gysi, 18). Der Journalist Robert La Puente bestätigt das, er geht vor allem den auffälligen Steuerungs- und Kontrollmechanismen in der öffentlichen Diskussion nach. Und der Politologe Christoph Lövenich kommt in seiner detaillierten Analyse der inkriminierten Veröffentlichungen zu dem Fazit, dass es sich „bei den betroffenen Büchern Ulrike Guérots … nicht um Plagiate“ (Gysi, 41) im justiziablen Sinne handelt, wie es etwa beim Verteidigungsminister Guttenberg der Fall war.
Die Universität Bonn nahm die Vorwürfe trotzdem zum Anlass einer Kündigung – und seitdem läuft ein Arbeitsgerichtsverfahren, dessen Ausgang offen ist. In dem Sammelband ist dazu die Stellungnahme der Bonner Universität abgedruckt, die sich im Oktober 2022 noch ohne Namensnennung „von einem Mitglied der Philosophischen Fakultät“ distanzierte und sich – für eine Hochschule eher ungewöhnlich – mit der Nato-Position identifizierte. Das Buch dokumentiert zudem eine Erklärung des Verlags, die ebenfalls die ungewöhnliche Koordination der öffentlichen Angriffe auf Guérot hervorhebt, was auch anhand einer Liste von über 50 Medienbeiträgen belegt wird. In der Hauptsache zeigen diese das Faktum einer abgestimmten öffentliche Stimmungsmache, wie Gysi schreibt, also das, „was mit einem prominenten Bürger passiert, der sich den ‚Wahrheiten‘ und der Macht des Mainstreams entgegenstellt“ (Gysi, 76).
Deutsche Dissidenz 2022ff
In der Tat, es ist ein eindeutiger Fall von Dissidenz, der von einer erstaunlich selbstverständlichen Gleichschaltung im Wissenschafts- und Medienbetrieb zeugt. Der von Gysi erhobene Vorwurf der „versuchten Hinrichtung“ greift dabei etwas hoch. Vertretbar ist er, weil er die Heftigkeit und Zielstrebigkeit der Kampagne trifft. Allem Anschein gehört dazu auch die Tatsache, dass das Arbeitsgerichtsverfahren (das für die Bonner Universität mit einem peinlichen Ausgang enden könnte) immer wieder verschoben wird. So kann man auch ein unbequeme Person mürbe machen!
Wichtig ist hier aber vor allem, dass ein Exempel statuiert wird. Huisken schreibt dazu: „Die hierzulande durchgesetzte Parteilichkeit für den Ukrainekrieg und die deutsche Beteiligung an ihm stellt längst keine bloße Meinung dar, sondern weiß sich bereits zur antikritischen Fahndung beauftragt“ (Huisken, 83). Und dieses Signal sei im Wissenschaftsbetrieb angekommen. In der Tat, in der Hochschulgemeinde gibt es keine Aufregung darüber, was mit einer Person aus ihrem Kreis angestellt wird. Im Gegenteil, Versuche, das Buch von Gysi bekannt zu machen, stoßen etwa in der Fachöffentlichkeit auf große Bedenken. Da müssen die Zuständigen der öffentlichen Verurteilung gar nicht zustimmen, es reicht das Wissen, dass es besser ist, dieses heiße Eisen nicht anzufassen.
P.S. Noch eine abschließende Bemerkung zum Vorwurf der versuchten „Hinrichtung“, der als unangemessen erscheinen könnte. Vielleicht wäre es besser, um hier ein passendes Bild zu wählen, von einer Hexenjagd zu sprechen. La Puentes Beitrag in dem Sammelband lässt ja erkennen, dass in diesem Fall auch Ressentiments gegen eine öffentlich präsente und selbstbewusst auftretende Frau mit im Spiel sind. So wie es aussieht, ist eine akademisch-pressemäßig gut vernetzte Männerclique dabei, eine unbequeme Autorin aus der Gemeinschaft der anständigen Deutschen auszuschließen – ein Vorgang, der von denjenigen, die sich sonst vor Gendersensibilität überschlagen, ziemlich gelassen hingenommen wird.
Einer aus der besagten Clique, der wohl auch eine führende Rolle bei der Kampagne spielt, ist der FAZ-Redakteur Patrick Bahners. Der lässt kaum eine Gelegenheit aus, Guérot ins Abseits zu stellen. In seinem neuesten Buch „Die Wiederkehr“ über die AfD (2023) erwähnt er z. B. Guérots Klage, dass derzeit „kritische Meinungen marginalisiert, diffamiert und stigmatisiert“ (Bahners, 222) würden. Das empfindet der FAZ-Mann, der in und mit seinem Blatt einen wesentlichen Beitrag dazu leistet, welche Meinungen in Deutschland zählen, als einen Witz. Davon sei nichts zu entdecken, „in einem Wörterbuch der Gemeinplätze des gegenwärtigen Weltmoments müsste die Idee der Gefährdung der Meinungsfreiheit durch die Herrschaft des Mainstreams einen Sonderplatz einnehmen“ (Bahners, 223). Dissidenz im liberalsten Deutschland, das es je gab – da kann der Profi der veröffentlichten Meinung nur lachen!
Literatur
Patrick Bahners, Die Wiederkehr – Die AfD und der neue deutsche Nationalismus. Stuttgart (Klett-Cotta) 2023.
Gabriele Gysi (Hg.), Der Fall Ulrike Guérot – Versuche einer Hinrichtung. Frankfurt/Main (Westend) 2023 https://www.westendverlag.de/buch/der-fall-ulrike-guerot/
Freerk Huisken, Frieden – Eine Kritik. Aus aktuellem Anlass. Hamburg (VSA) 2023.
Siehe auch die Beiträge auf der IVA-Website unter Texte2023: Der Fall Guérot I und Der Fall Guérot II .
Januar
Eine Bewegung, die (fast) nichts bewegt
Ende 2023 legte Rudolf Netzsch eine Veröffentlichung zu Klimakatastrophe und -protest vor. Hier einige Hinweise von Johannes Schillo dazu, welche Debatte damit eröffnet ist.
Der Naturwissenschaftler Rudolf Netzsch hat kürzlich das Buch „Nicht nur das Klima spielt verrückt“ (2023) vorgelegt. Es widmet sich einer „Verrücktheit“, die wir alle auf dem Globus – hier stimmt ausnahmsweise einmal der menschheitsverbrüdernde Ausdruck! – Tag für Tag besichtigen können: Die Klimakatastrophe ist laut sämtlichen sachkundigen Dia- und Prognosen unterwegs und ja auch in internationalen Vereinbarungen als erstrangiges Menschheitsproblem anerkannt. Die Konsequenz, die die Staatenwelt daraus zieht, ist aber im Grunde nichts anderes als business as usual.
Ist das verrückt?
Ja, dazu kann man Wahnsinn sagen. Doch hat er Methode, wie der Autor im detaillierten Durchgang durch die Problemlage nachweist, wobei mit „business“ bereits der entscheidende Punkt benannt ist. Das kapitalistische Geschäftsleben (und die dazu gehörige militärische Gewalt – eine gigantische Naturzerstörungsapparatur, die aber auf den einschlägigen Konferenzen nie Thema ist) hat mit seiner Programmierung auf Naturverschleiß und Wachstum Sachzwänge etabliert, die jede Schutzmaßnahme gleich zu einem Kostenproblem machen. Obwohl man weiß, was droht, ist daher die Abwendung der Gefahr wie auch die Beseitigung der eingetretenen Schäden immer eine Angelegenheit von relativer Dringlichkeit.
Staaten, die sich der Förderung des Wirtschaftswachstums verpflichtet fühlen – und wer ist das heutzutage nicht? –, sind beim Schutz der Natur vor den katastrophalen Auswirkungen des Wachstumszwangs, die ja gar nicht geleugnet, sondern bei Gelegenheit, auf Konferenzen und in Sonntagsreden, groß an die Wand gemalt werden, immer mit dem Problem konfrontiert, Ökonomie und Ökologie zu vereinbaren. So die offizielle Sprachregelung, die die Relativität des Umweltanliegens deutlich macht. Die Marktwirtschaft muss weiter ihren Gang gehen und sehen, ob und wie sehr sich die erneuerbaren Energien rechnen. Eine Energiewende ist ja durchaus unterwegs, die man aber eher – siehe die Analysen von Schadt und Weis (2022, 2023) – als „deutschen Energieimperialismus“ einordnen muss. Und vielleicht wird sie als ‚Kollateralnutzen‘ auch die eine oder andere Verbesserung im Hinblick auf den Klimawandel mit sich bringen…
Bis es soweit ist, gibt es neben dem großen Projekt der Transformation des Kapitalstandorts nicht nur staatlich geduldetes „Greenwashing“, sondern auch tolle Ideen zu einem in Zukunft – eventuell – möglichen „Geoengineering“, das die Emission der Treibhausgase weiterlaufen lassen und mit neuen Erfindungen später wieder einfangen will. So werden, wie Netzsch resümiert, „Vorschläge, die jeder unvoreingenommene Mensch sofort als Schnapsidee abweisen würde, dennoch von offizieller Seite ernsthaft ins Gespräch gebracht und auch noch mit Fördergeldern akademisch ausgearbeitet.“ (Netzsch, 119)
All das weiß die Protestbewegung – von den Fridays for Future bis zur Letzten Generation; sie weiß auch, dass moralische Appelle zur Änderung des individuellen Konsumverhaltens und zu einem allgemeinen Umdenken in der Bevölkerung nicht weiter helfen, so lange die Rahmenbedingungen die alten bleiben. Netzsch – der diese Individualisierung des Problems in den beiden ersten Kapiteln seines Buchs thematisiert – zeigt aber, dass die Schwachstelle des Protests gerade da liegt, wo der Rahmen, den das System setzt, in den Blick geraten müsste.
Wogegen hat sich sich die Forderung nach einem system change (der ja, wie die Parole heißt, statt climate change stattfinden soll) zu wenden und mit welchen Mächten bekommt sie es dabei zu tun? Das ist die Leitfrage des Buchs, das also nicht noch einmal eine Bilanz der Umweltverwüstungen liefert, sondern sich auf die Gründe der Misere – und damit auf die einzig erfolgversprechende Perspektive einer „Problemlösung“ – konzentriert.
Marx – ein Ökologe?
Konsequenter Weise geht Netzsch auf die Marxsche Kritik der politischen Ökonomie zurück, denn diese hat ja zum ersten Mal in stringenter Form die Wachstumsnotwendigkeit der kapitalistischen Produktionsweise erklärt und dabei gleich in umfassender Weise kritisiert. Die kritisierte Notwendigkeit ergibt sich nicht einfach aus dem Sachverhalt, dass Naturbeherrschung und -verbrauch für menschliche Bedürfnisbefriedigung stattfindet, wie das marktwirtschaftliche Apologeten behaupten, aber auch Aufrufe zur Bewahrung der Schöpfung, so etwa Papst Franziskus in seiner Umweltenzyklika Laudato si’, unterstellen. Sie folgt vielmehr aus dem speziellen Zweck, der in der marktwirtschaftlichen Praxis gnadenlos waltet: Abstrakter Reichtum ist das Ziel, die Produktion ist Verwertung eines eingesetzten Werts und das gelungene, aber in der Konkurrenz immer wieder durchzusetzende Resultat ist das Einstreichen eines vermehrten Geldbetrags. Und addiert als gesamtwirtschaftliche Leistung gibt dann eine einzige Zahl, die prozentuale Angabe, ob und wie sehr die Vorjahressumme gesteigert werden konnte, Auskunft darüber, ob das Wirtschaftsleben „gesund“ ist oder zu kränkeln anfängt. Netzsch zitiert natürlich das berühmte Fazit von Karl Marx im ersten Band des „Kapital“, worauf auch andere Kritiker wie z.B. Kohei Saito (2016) verweisen, das die Konsequenzen einer solchen Produktionslogik benennt: „Die kapitalistische Produktion entwickelt nur die Technik und Kombination des gesellschaftlichen Produktionsprozesses, indem sie zugleich die Springquellen allen Reichtums untergräbt: die Erde und den Arbeiter.“ (MEW, Bd. 23, S. 529f) Netzsch gibt mit seinem Buch in der Hauptsache einen konzisen, gut verständlichen Überblick über die Marxsche Kritik und erinnert auch daran, dass Marx selber schon ökologische Studien betrieben hat.
Er stellte etwa Studien zur Agrarwissenschaft an, die zu seiner Zeit entstand und die sich mit Möglichkeiten der chemischen Bodenbearbeitung befasste. Er widmete sich also einem Thema, das dann 100 Jahre später (natürlich unter den fortgeschrittenen naturwissenschaftlichen und technologischen Bedingungen) von der Biologin Rachel Carson aufgegriffen wurde. Carson kritisierte die gefährlichen Folgen der modernen landwirtschaftlichen Bodennutzung und die Auswirkungen einer rigorosen Unkrautvernichtung auf Ökosysteme, wobei ihr Bestseller „Silent Spring“ („Der stumme Frühling“) aus dem Jahr 1962 „häufig als Ausgangspunkt der US-amerikanischen Umweltbewegung bezeichnet wird“ (Wikipedia).
Friedrich Engels hatte sich schon in seinen frühen Schriften zu Umweltproblemen geäußert, so zur Verpestung der Luft und zur Verschmutzung von Gewässern in seinem Bericht über „Die Lage der arbeitenden Klasse in England“ (1845, MEW, Bd. 2, S. 225ff). Seine „Umrisse zu einer Kritik der Nationalökonomie“ von 1844 (MEW, Bd. 1, S. 505), die die Marxsche Kritik der politischen Ökonomie entscheidend beeinflussten, sprachen dann hoffnungsvoll vom „großen Umschwung, dem das [19.] Jahrhundert entgegengeht, der Versöhnung der Menschen mit der Natur und mit sich selbst.“
Eine eigene Umweltbewegung war damals jedoch nicht im Programm. Den großen Umschwung sahen Marx und Engels in der Entstehung der Arbeiterbewegung. Durch diese sollten die Klassenherrschaft und damit auch die Gründe der Naturzerstörung beseitigt werden; das hieß für die politische Arbeit, sich auf die Förderung dieser internationalen Bewegung zu konzentrieren. „Entsprechend standen auch in der theoretischen Arbeit die dafür unmittelbar relevanten Themen im Vordergrund“ (Netzsch, 80), was eben keine Ignoranz gegenüber der ökologischen Frage bedeutete. Man setzte nämlich auf den – scheinbar – nahe liegenden Erfolg der antikapitalistischen Bewegung.
Etwas bewegen?
Der Schlussteil des Buchs geht auf das Resultat ein, das heute jeder kennt: Die Arbeiterbewegung ist Historie, genauer gesagt: Sie wurde vom Staat eingehegt, so dass dieser heute als selbstverständlicher Adressat aller Beschwerden gilt, ob sie sich nun auf den Schutz der arbeitenden Menschen oder der natürlichen Lebensgrundlagen beziehen (siehe Schillo 2024). Und in der Tat, der Staat, der sich der Aufrechterhaltung des Kapitalismus verpflichtet weiß, macht ja sowohl Sozial- als auch Umweltpolitik. In dem Sinne können auch Proteste, die sich gegen die Erosion des sozialen Zusammenhalts oder die Zerstörung der nationalen Naturbedingungen beziehen, etwas bewirken. Anerkannt sind solche Klagen sowieso, wenn sie die Sorgen des einfachen Volks an die wirklich Zuständigen zurückmelden oder auf Funktionserfordernisse einer kapitalistischen Ökonomie aufmerksam machen.
Was sie nicht bewirken, ist die Außerkraftsetzung des kapitalistischen Akkumulationsprozesses, der die von Marx aufgespießte „Untergrabung“ sachzwangmäßig vorantreibt. Die als politikfähig gehandelten ökologischen Konzepte – von den Mogelpackungen des Greenwashing über Grünes Wachstum und Degrowth bis hin zu den Parolen des „Small is beautiful“ – wollen hier ein realistisches Angebot machen, bleiben aber illusionär, wie Netzsch in einer ausführlichen Kritik nachweist. Dabei wird auch wieder deutlich, dass die Umweltbewegung, so wie sie heute mehrheitlich unterwegs ist, mit Forderungen nach einer Postwachstumsökonomie oder Ähnlichem ihren Frieden mit dem angefeindeten System macht. Letztlich soll es doch eine Verhaltensänderung von uns allen sein, mit der auf die drohenden Gefahren zu antworten ist.
Man muss eben handeln. Die Zeit drängt schließlich. Die Zeit drängt natürlich auch an einer anderen Stelle: Wenn man die derzeitige – quantitativ eher überschaubare, in ihrer Öffentlichkeitswirkung dem Umweltprotest vergleichbare – Friedensbewegung nimmt, so kann diese mit gleichem Recht darauf verweisen, dass sie das existentielle Menschheitsanliegen vertritt. Denn wenn es zum nuklearen Holocaust kommt, dann wird die Erde unbewohnbar, bevor die Klimakatastrophe ihre volle Wucht entfaltet.
Was in der gegenwärtigen Lage Not tut, da kann man der Kritik von Netzsch nur zustimmen, ist die Aufklärung darüber, wo die Gründe des angeprangerten Desasters liegen. Das brauchen die Aktivisten des Protests, um sich selber klar zu machen, was anzugreifen und außer Kraft zu setzen ist, und um damit dann auf ihr Publikum loszugehen – statt die Enttäuschung über das Versagen der Politiker immer wieder aufs Neue zu verbreiten.
Das wäre das Entscheidende, das eine Bewegung, die sich seit Jahrzehnten auf offiziell anerkannte hehre Ziele beruft und deren praktische Bedeutungslosigkeit beklagt, zu klären hätte. Wie sich dann Bewegungen, die die Übel der herrschenden Verhältnisse beim Namen nennen, zueinander stellen sollten, wäre im Einzelnen zu thematisieren. Wenn sie etwas bewegen wollen, müssen sie aber auf jeden Fall die von Netzsch dargelegte Einsicht berücksichtigen: Es handelt sich hier nicht um diverse Übel, die sich jeweils Fehlgriffen oder Fehlbesetzungen in der Politik verdanken. Sie haben vielmehr System!
Nachweise:
Rachel Carson, Silent Spring. US-Originalausgabe: Boston 1962. Deutsche Ausgabe: „Der stumme Frühling“, 1963.
MEW – Marx-Engels-Werke. Berlin (Dietz) 1965ff.
Rudolf Netzsch, Nicht nur das Klima spielt verrückt – Über das geistige Klima in der heutigen Gesellschaft und die fatalen Folgen für das wirkliche Klima der Welt. München (Literareon im Utzverlag) 2023, 204 Seiten, 17,50 Euro, ISBN 978-3-8316-2420-1 https://www.literareon.de/index.php/catalog/book/42420.
Kohei Saito, Natur gegen Kapital – Marx‘ Ökologie in seiner unvollendeten Kritik des Kapitalismus. Frankfurt/Main (Campus) 2016.
Peter Schadt/Nathan Weis, High Energy – Nord Stream 2 ist gestoppt. Deutschland will trotzdem zum bestimmenden energiepolitischen Akteur werden. In: Konkret, Nr. 4, 2022.
Peter Schadt/Nathan Weis, Deutsches Wesen – Über den deutschen Energieimperialismus. Zweiter Teil einer Serie. In: Konkret, Nr. 1, 2023.
Johannes Schillo, Arbeiterbewegung und Umweltbewegung. In: Gewerkschaftsforum, 27.1.2024 https://gewerkschaftsforum.de/arbeiterbewegung-und-umweltbewegung/.
Flucht und Migration – die deutsche Nation schlägt Alarm!
Im Overton-Magazin erschien jüngst ein Beitrag von Johannes Schillo zu Flucht und Migration, die nach sachkundiger Auskunft einen einzigen Anschlag auf „uns“ darstellen sollen. Hier eine aktualisierte Fassung des Beitrags.
Gestern herrschte noch von Meloni bis von der Leyen, von Scholz bis Höcke große Einigkeit bei europäischen Politikern, dass die „Irreguläre Migration“ das neue Schreckensszenario Nr. 1 darstellt und dass hier ein Kampf gegen den „Kontrollverlust“ angesagt ist. Heute entdeckt man, dass die AfD unverdrossen mit dem Thema Politik macht und das Schlagwort „Remigration“ besetzt, worauf die demokratischen Rivalen es zum Unwort des Jahres erklären lassen. Und ab dem nächsten Tag arbeiten diese dann wieder mit voller Tatkraft daran, dass nachhaltig abgeschoben, an den Grenzen scharf kontrolliert und rücksichtslos abgeschottet wird.
Die große Not
Kanzler Scholz hält nämlich – wie die meisten regierenden Politiker – nichts davon, die AfD zu verbieten. Dass die Rechten hier ein drängendes Problem der nationalen Agenda ausschlachten, ist ihm klar. Und aus seiner Partei wird er ja, nachdem jetzt das Aufreger-Thema Migration die AfD wieder ins Rampenlicht gebracht hat, dazu aufgefordert, „bei der ‚Begrenzung der Migration … mutiger‘ zu werden und ‚den Konflikt mit den Grünen in Kauf zu nehmen‘.“ (Junge Welt, 16.1.24) Da kann man dem Kommentar der JW nur zustimmen: Das Gegenrezept besteht darin, „rechte Politikansätze zu übernehmen“.
Die große Not, die „uns“ durch Flucht und Migration droht, wird von Journalisten und Politikexperten dem Publikum regelmäßig vorgeführt, wobei es aber auffällige Leerstellen oder Problemverschiebungen gibt. Zum Beispiel findet „eine der größten Massenvertreibungen der Gegenwart“ in Pakistan statt, wo rund zwei Millionen afghanische Geflüchtete gezwungen werden, das Land zu verlassen – und zwar unter dem fadenscheinigen Vorwand: „Kollektiver Terrorverdacht“. Über diese Katastrophe berichtete jüngst Emran Feroz im //Overton//-Magazin und verwies zugleich auf das Desinteresse des – wertebasierten – Westens an dieser Not: Der Zynismus Pakistans, das jahrzehntelang militante Gruppierungen im Nachbarland unterstützte und jetzt auf seine Weise die Kriegsfolgen aufarbeitet, rufe in der Weltöffentlichkeit keine Aufregung hervor, alarmiere auch nicht die Politik.
Wenn ein Weltblatt wie die FAZ (23.12.23) dagegen zum Fest des Friedens nach Finnland blickt, ist die Aufregung groß. An der Grenze zu Russland sei das neue skandinavische Nato-Mitglied „auf hybride Angriffe seit Langem eingestellt – nun sind sie erfolgt“. Wie das? Kamen Raketen an, hat der Russe schon wieder ein Land überfallen? Nein, viel heimtückischer, „innerhalb weniger Wochen (kamen) 1200 Asylsuchende über die Grenze – für ein Land wie Finnland eine große Zahl. Berichten zufolge warten kurz hinter der Grenze viele weitere Migranten.“
Dass Russland nicht bereit ist, den Dienstleister an der EU-Abschottung zu spielen, sondern Flüchtende (die angeblich meist nach Deutschland streben) ziehen lässt, soll ein einziger Skandal, ja sogar der Kriegsfall sein. „Es handelt sich offensichtlich nicht um ein Flüchtlingsthema, sondern um hybride Kriegführung“, sagte der Vorsitzende des finnischen Verteidigungsausschusses, der die Gefahr von Millionen Eindringlingen beschwor und quasi den europäischen Verteidigungsfall ausrief: „Wir handeln hier für die gesamte EU.“
Flucht und Migration nach der Zeitenwende
Im Blick auf die deutsche Zeitenwende hat Norbert Wohlfahrt zuletzt in der Jungen Welt ( „Ideal im Staatskorsett“) Bilanz dazu gezogen, wie der westliche bzw. europäische Nationalismus seinen Humanismus neu ordnet. Denn der an Werten orientierte Westen sieht bei sich großen Handlungsbedarf. Dass die westlichen Kriege im Nahen oder Mittleren Osten Millionen Menschen in die Flucht treiben und die dortigen Anrainerstaaten vor größte Herausforderungen stellen, ist dagegen deren Problem, zu dem dann die UNO-Hilfswerke – je nachdem – Flüchtlingslager oder Care-Pakete beisteuern. Die Islamische Republik Iran z. B., das kann man von der //UNO-Flüchtlingshilfe// erfahren, beherbergt eine große Zahl afghanischer Flüchtlinge. Bis Ende 2020 waren es rund 780.000 registrierte. Zusätzlich befinden sich Schätzungen zufolge mehrere Millionen Menschen aus Afghanistan ohne Ausweisdokumente im Iran. Zigtausende Iraker sind dorthin auch vor dem Irak-Krieg geflohen.
Aber Iran oder Pakistan haben in solchen Fragen weltordnungspolitisch nichts zu melden (und Ähnliches gilt für afrikanische Länder). Sie sollen sehen, wie sie mit „unseren“ Kriegsfolgen zurechtkommen, nachdem z. B. Nato-Staaten, darunter vorneweg die Bundeswehr als einer der großen Truppensteller, 20 Jahre lang in Afghanistan gewütet haben. Der eigentlich Betroffene sind nämlich wir, wie Wohlfahrt jetzt die hiesigen Debatten unter Politikexperten und -beratern resümiert:
„Das Subjekt der humanitären Ordnung der Flüchtlingspolitik sind die Demokratien der westlichen Welt, die ihren humanitären Auftrag durch ‚geschlossene Grenzen‘ entweder gefährden oder aufgerufen sind, nationale Interessen in der Flüchtlingspolitik stärker zur Geltung kommen zu lassen. Das Insistieren auf der Fortdauer einer humanitären Flüchtlingspolitik oder der Rettung derselben durch mehr Abschottung geht von der felsenfesten Überzeugung aus, dass der humanitäre Auftrag der Menschenrechte nur durch diejenigen eingelöst werden kann, die diese zum Leitmotiv der postkolonialen Neuordnung der Welt gemacht haben.“ (N. Wohlfahrt)
Die Einlösung menschenrechtlich begründeter Ansprüche war jedoch nie einfach als Hilfe für Notleidende oder gar als Abschaffung menschenfeindllicher Lebensumstände gedacht. Es sollte vielmehr ein globaler Kapitalismus durch ein Rechts- und Wertesystem durchgesetzt und aufrechterhalten werden, das sich die – schon existierenden oder in die Unabhängigkeit zu entlassenden – Nationalstaaten dann zu eigen zu machen und bei ihrem souveränen Handeln als Orientierungspunkt zu respektieren hatten.
Der Humanismus des Völker- und Menschenrechts abstrahierte gleichzeitig von den politökonomischen Grundlagen, auf denen sich die Freiheit & Gleichheit konkurrierender Wirtschaftsbürger und ihrer Standorte vollzieht, und betrachtete folgerichtig Hunger, Krieg und Flucht als Produkt gelungener oder gescheiterter Nationalstaatlichkeit. So gilt im Rahmen der US-Weltordnung seit 1948 die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, sie fasst das Ideal einer Welt souveräner Nationalstaaten ins Auge, die ihren Völkern gleiche Rechte gewähren und internationale Abkommen und Verträge respektieren. Das Recht auf Leben und Freiheit, Gleichheit vor dem Gesetz und das Verbot der Sklaverei korrespondieren dabei mit einem humanitären Auftrag, der u. a. jedem das Recht zuweist, in anderen Ländern vor Verfolgung Asyl zu suchen und zu genießen (Art. 14).
Deutschland muss handeln
Wie Norbert Wohlfahrt jetzt anhand der deutschen Debatte zeigt, ist dieser Humanismus geregelter Staatlichkeit, der mit Asylrecht und Hilfswerken den Staatenverkehr flankiert, nicht mehr zeitgemäß. Aber nicht, wie eingangs erwähnt, weil das Elend der armen Länder zum Himmel schreit. Vordenker deutscher Politik wie Hans-Peter Schwarz sehen vielmehr – ganz im Einklang mit den politischen Ansagen – eine „neue Völkerwanderung nach Europa“ unterwegs und räsonieren „über den Verlust politischer Kontrolle und moralischer Gewissheiten“. „Wir“ sind jetzt bedroht, der Universalismus der früheren Asylrechtsreglung passt nicht mehr zu einer Welt, in der nach der Zeitenwende eine globale Frontbildung stattfindet.
„In dieser Situation“, resümiert Wohlfahrt, „führt der russische ‚Angriffskrieg‘ zu einem Schub humanitärer Herausforderungen, die die Flüchtlings- und Asylpolitik zu einem Baustein der umfassenden Militarisierung und Kriegsvorbereitung werden lassen.“ Human ist heute eine Politik, die zu unterscheiden weiß, die z. B. Millionen ukrainische Flüchtlinge zu Sonderkonditionen in die EU lässt – „Im Dezember 2023 sind in den Ländern Europas rund 5,9 Millionen Flüchtlinge aus der Ukraine registriert“ (https://de.statista.com) – und die an anderer Stelle, wenn es etwa um Afrika geht, auf schärfster Abschottung besteht. Oder die den Welt(arbeits)markt zur Behebung des deutschen Fachkräftemangels durchmustert, aber bei gewöhnlichen Wirtschaftsflüchtlingen kein Pardon kennt.
Wichtig ist eben, dass „wir“ die Kontrolle über die weltweiten Fluchtbewegungen behalten. Alt-Bundespräsident Gauck warnt dementsprechend im Bild-Interview (bild.de, 7.1.24) „vor unbegrenzter Migration“ und wirft im Blick auf die Politik der Ampelregierung, die gerade dieselbe Sorge umtreibt, die Frage auf: „Wollt ihr, dass ein Kontrollverlust eintritt?“ Das Lösen der „Migrationskrise“ bedarf aus Gaucks Sicht „einer gewissen Entschlossenheit und mitunter auch der Härte“. „Für viele Christenmenschen, die anderen, denen es schlecht geht, helfen wollen“, sei das eine harte Probe – so viel pfäffisches Mitgefühl bringt Pfarrer Gauck noch auf. Aber der Realist in ihm weiß, dass man den Rechten nicht das Feld überlassen darf: „Auf der anderen Seite muss man diese Menschen dann fragen: Wollt ihr denn, dass in Europa ein Kontrollverlust eintritt, und dass dann nicht nur 20 oder 30 Prozent Rechtsaußen wählen, sondern 40 oder 50 Prozent?“
Unterm Strich bleibt: Politik muss Härte zeigen, wenn es gilt, im Innern oder im Äußern Störenfriede auszuschalten. Die Zurückdrängung des russischen – und perspektivisch: des chinesischen – Feindes stellt den Humanismus des Menschen- und Völkerrechts ganz in den Dienst des Nationalismus der sich „kriegstüchtig“ (Pistorius) machenden Staatenwelt. Passend dazu die Alarmmeldung der FAZ aus den Weihnachtstagen, dass Putin jetzt schon (wie seinerzeit Lukaschenko) Flüchtlinge als Waffe einsetzt.